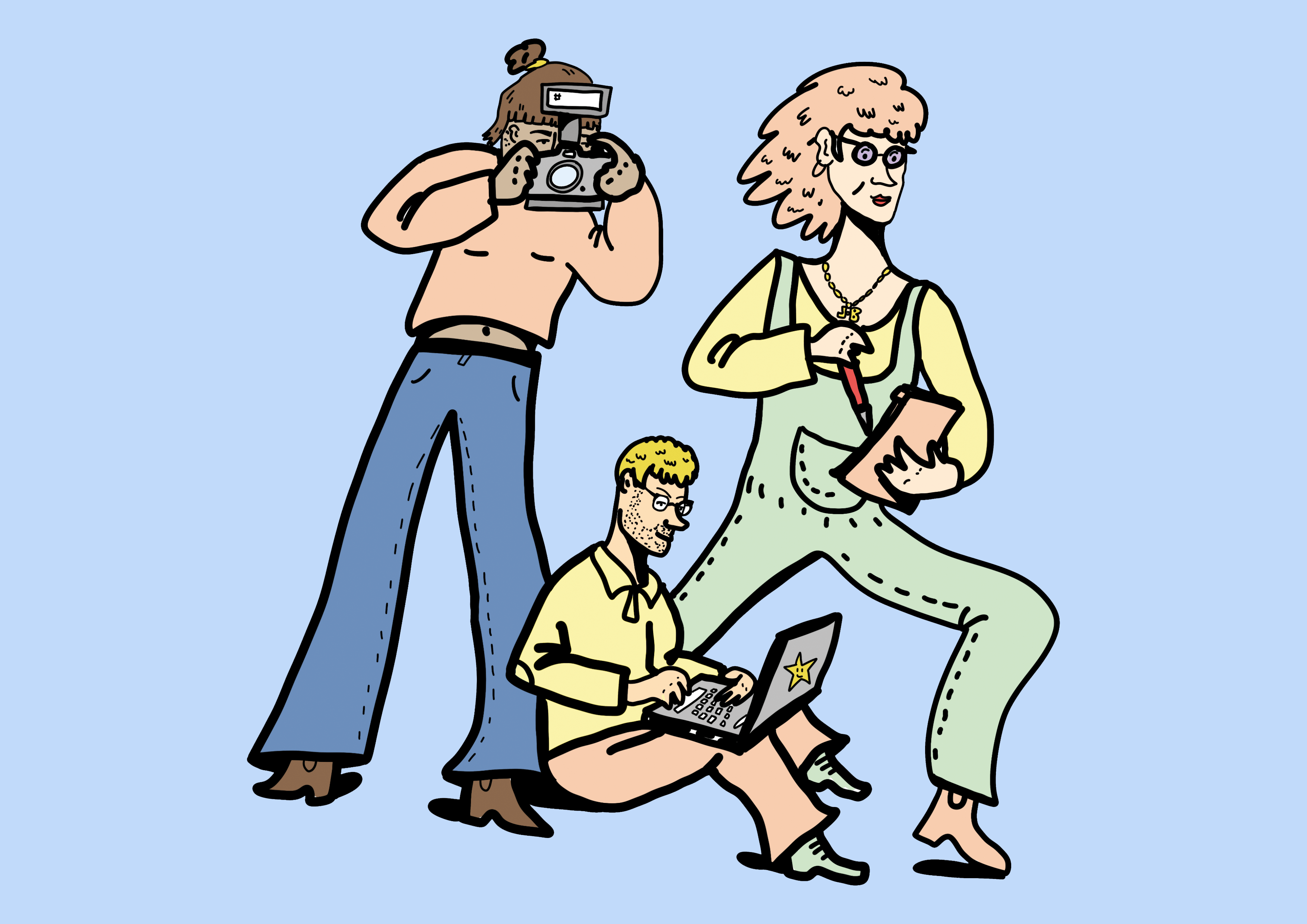Über das System der Fallpauschalen (für stationäre Leistungen) und die Tarmed-Entschädigungen (für ambulante Behandlungen) müssen sich die Spitäler vollständig finanzieren. Betriebliche Defizite deckt niemand, auch Investitionen müssen vom Spital selbst finanziert werden. Nur für gemeinwirtschaftliche Leistungen kommen die Kantone in unterschiedlichem Umfang auf. Am Inselspital Bern etwa deckt der Kanton die Leistungen in der Lehre und Forschung sowie für die Weiterbildung der Ärztinnen und Ärzte.
Praktisch keine weitere Finanzierung
Das war anders vor 2012. In der damaligen Einschätzung erbrachte ein Spital öffentliche Leistungen, deren Finanzierung der Kanton auch mit Defizitbeiträgen garantierte. Das Stichwort hiess «Service public», es war so wie es heute noch im Bildungswesen oder bei der Polizei ist. Heute gelten bei der Gesundheit Wettbewerb und standardisierte Tarifsysteme.
Das System der Fallkostenpauschalen ist das zentrale Finanzierungssystem für unsere Spitäler. «Der Gesetzgeber wollte damit Markttransparenz und Wettbewerb zwischen den Spitälern fördern und Anreize zur ‘Effizienzsteigerung’ im Spitalbetrieb setzen», sagt Bernhard Pulver, seit zwei Jahren Präsident des Verwaltungsrats der Insel Gruppe AG. Das Parlament setzt bewusst wirtschaftlichen Druck auf. Die Annahme: Es werde zu teuer gearbeitet, man müsse und könne die Kosten immer noch mehr senken; denn letztlich kosteten die Spitäler zu viel.
Peter Siegenthaler, ehemaliger Direktor der Eidgenössischen Finanzverwaltung und ex Verwaltungsratsmitglied der Insel sagt es so: «Im System der Fallkostenpauschalen hat ein Spital im Wesentlichen nur noch 2 Möglichkeiten, seine Erträge positiv zu beeinflussen: durch eine Verlagerung seines Leistungsangebots hin zu Behandlungen mit hohem Kostengewicht (z.B. Eingriffe und Untersuchungen mit kostspieligen Apparaten) und durch Mengenausweitungen. Beides erhöht die Gesundheitskosten, kompensiert damit die erhofften Einsparungen aus dem Systemwechsel, erhöht den Kostendruck auf das Personal und verführt die Spitäler zu einer Investitionspolitik, die sie längerfristig nicht werden durchhalten können. All dies läuft einer Entwicklung entgegen, die dem menschlichen Faktor sowohl auf Seiten des Personals als auch auf Seiten des Patienten wieder vermehrt Gewicht geben möchte.»
Fragen
Was bedeutet dies? Hat «die Politik» recht mit dem systematischen Kostendruck? Führt dieser zu günstigeren Leistungen – oder auch zu schlechteren? Was ist gut, was schlecht? Was lässt sich innerhalb des geltenden Systems ändern und wofür braucht es eine Änderung des Systems? Zudem: Wer hat den Durchblick, der nicht irgendwie Partei ist, ein Interesse vertritt, einen Besitzstand wahrt (vielleicht unbewusst) – wer also kann kompetent aus Sicht «der Patientinnen und Patienten» mitreden? Gibt es eine einzige Patientensicht oder splittert sich diese auf in Sichten der Jungen, der Alten, der Gesunden und der (Chronisch-)Kranken, der leicht oder schwer Betroffenen – wobei wir im Lauf des Lebens manchmal zu dieser, manchmal zu jener Gruppe gehören?
Obwohl schwierig zu ermitteln – es sind die Sichtweisen der Nicht-Fachleute, der von Fall zu Fall auf die Fachleute Angewiesenen, es sind unsere Sichtweisen, auf die es im Grund ankommt. Denn wozu ist das Gesundheitswesen als um uns gesund zu erhalten bzw. wieder gesund zu machen? Doch sowenig das Publikum Gehör findet in der Kulturförderung, sowenig Kraft und Macht haben «die Leute», wir alle, in der Gesundheitspolitik. Fragt man uns nach den Prämien der Krankenkassen, finden wir sie querbeet zu hoch. Fragt man uns als Gesunde nach dem Spitalwesen, sehen wir Einsparungsmöglichkeiten überall; doch fragt man uns als Kranke oder Verunfallte – dann wünschen wir uns das Beste und fragen nicht nach den Kosten. Allerdings: Vielleicht würden auch die Gesunden Ja sagen zu einem solide finanzierten Gesundheitssystem, in dem die Ärztinnen und Ärzte und die Pflegenden genug Zeit haben, sich ausreichend um die Kranken und Verunfallten zu kümmern. Denn: «Jeder, der geboren wird, besitzt zwei Staatsbürgerschaften, eine im Reich der Gesunden und eine im Reich der Kranken» (Susan Sontag, in «Krankheit als Metapher», 1978 in der Zeit, als Aids aufkam).
Die Corona-Krise
2020, in der Zeit von Corona, werden die Berner Spitäler für ihre Vorhalteleistungen – das Freihalten von Betten auf den Intensivstationen und der monatelange Verzicht auf zeitlich nicht dringende Behandlungen anderer Krankheiten – aufgrund einer Not-Verordnung des Regierungsrats finanziell abgesichert. Sie erhalten die Differenz erstattet gegenüber dem Umsatz 2019, aber nichts für entgangenen Gewinn.
In der seit Wochen anbrandenden zweiten Welle von COVID-19 ist das Personal etwa im Inselspital die knappste Ressource. Für Patientinnen und Patienten in der Intensivstation braucht es rund um die Uhr Betreuung und Präsenz am Bett. Nötig sind Pflegende, die sich voll auf «ihre» Kranken konzentrieren und mit extremer Aufmerksamkeit die Geräte und Medikamente steuern können. Die Pflegenden müssen sehr gut ausgebildet sein. Die Beatmungsgeräte der Insel können nur soweit eingesetzt werden, wie qualifiziertes Personal zur Verfügung steht. Das ist der limitierende Faktor. Durch den Sommer konnten Überstunden genommen, Erschöpfungen überwunden, Unsicherheiten dank mehr Wissen über die Krankheit und deren Behandlung verringert werden – aber viele Limiten bestehen weiter.
In dieser Lage ist die Würdigung der Arbeit aller Pflegenden, der Ärztinnen und Ärzte sehr wichtig – symbolisch und ebenso materiell. Doch der materielle Dank ist im geltenden Finanzierungssystem sehr schwer möglich.
Wirkt der Kostendruck richtig?
Deshalb zurück zur Haltung des Gesetzgebers: Erreicht er mit seinen Beschlüssen, mit ständigem Kostendruck, was er anstrebt – gute Leistungen zu stets niedrigeren Preisen?
Das darf bezweifelt werden. Bernhard Pulver erklärt: «Ich persönlich glaube nicht, dass die vollständige Finanzierung der Angebote der Spitäler mittels Fallpauschalen zu einer Kostensenkung bei gleicher Qualität führen wird. Mein Eindruck ist der gegenteilige: Der ökonomische Druck und das stärker gewichtete ökonomische Denken wird einerseits zu einer Infragestellung der Qualität namentlich in der Patientenbetreuung und des menschlichen Aspekts in der medizinischen Betreuung der Patienten führen und andererseits zur Sicherstellung der Finanzierung auch nicht erwünschte und teilweise auch nicht sinnvolle Mengenausweitungen erzwingen. Die Kostenzunahme wird so mit anderen Vorzeichen weiter gehen.»
Pulver fährt fort: «Es gibt zahlreiche Ansätze, wie namentlich im Sinne einer ganzheitlichen und präventiven Medizin die Ressourcen der Menschen gestärkt werden könnten und auch die Leistungserbringer im Rahmen von Globalmodellen für die Gesundheit der ihnen anvertrauten Menschen und nicht nur für die Behandlung gesundheitlicher Störungen finanziert werden.»
Steigende Lohnkosten – dazu gehören bessere Löhne für die Pflege – sind vollständig durch die Fallpauschalen abzudecken. Die Einnahmen pro Fall sind jedoch in den letzten zehn Jahren gesunken. Und sie sollen weitersinken. Folglich fehlt Geld, um die Löhne anzuheben. Das ist ein defaitistisches Fazit. Darf es so bleiben?
Lesen Sie am 18. Dezember 2020 den dritten Teil des Essays: Wer rodet den Dschungel ohne erkennbare Gesamtverantwortung?