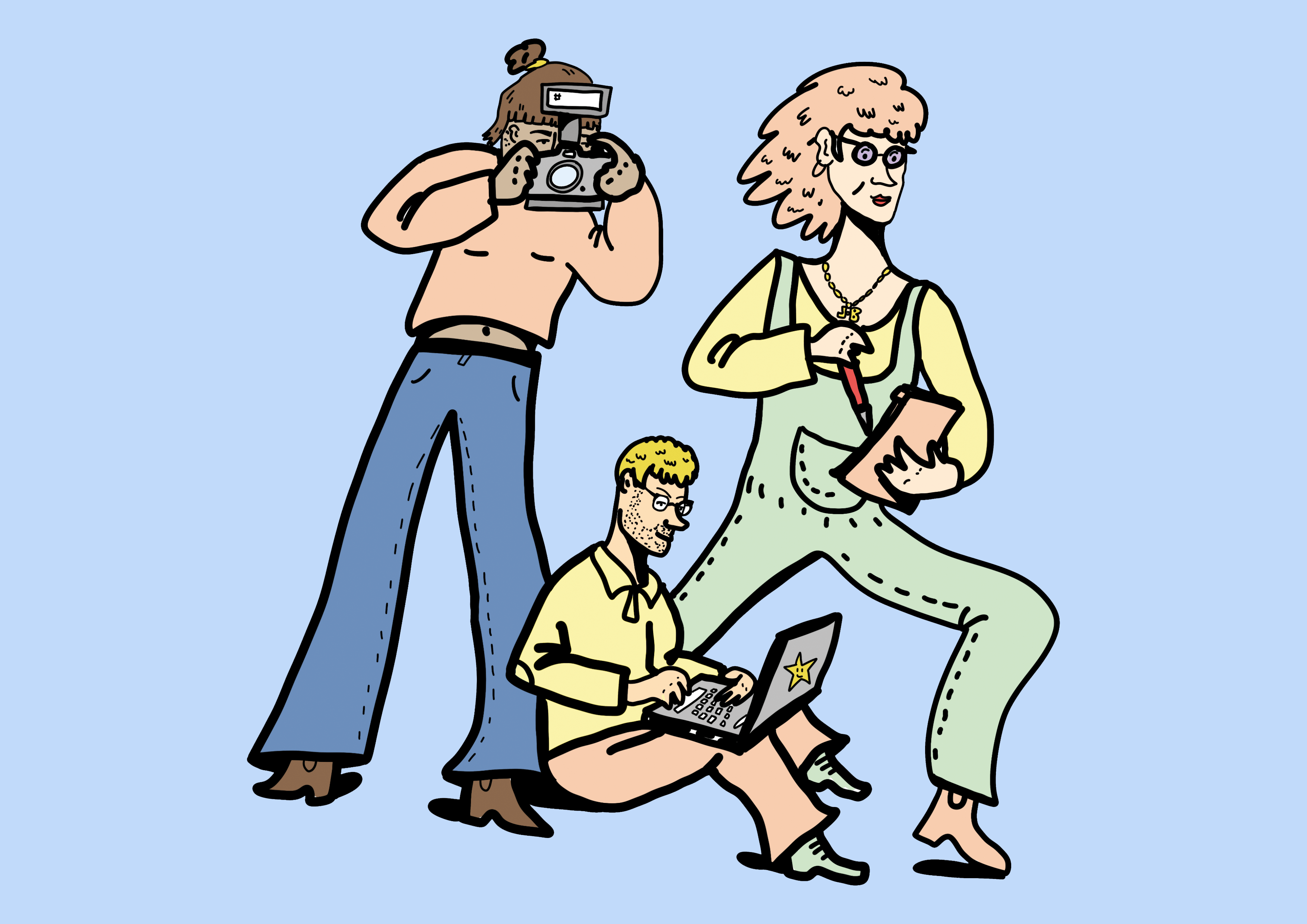Zum bevorstehenden fünfzigsten Geburtstag des Frauenstimm- und Wahlrechts in der Schweiz haben Rita Jost und Heidi Kronenberg ein Buch herausgegeben mit dem Titel «Gruß aus der Küche». Ausgerechnet. Ja, sind wir denn heute noch nicht weiter? Genau das fragten sich die beiden Herausgeberinnen und beauftragten einunddreissig schreibende Frauen – Journalistinnen, Kolumnistinnen, Autorinnen und Wissenschaftlerinnen – mit der Beantwortung dieser Frage. Was hat das Frauenstimm- und Wahlrecht uns gebracht und was nicht? Wie war es vorher? Zurückgekommen sind dreissig Texte, die erörtern, warum die Einführung des Frauenstimm- und Wahlrechts in der Schweiz so lange gedauert hat, die historische Informationen liefern, Pionierinnen ehren, Geschichten von früher erzählen, aber vor allem auch anprangern, persönliche Frustrationen äussern und mehr fordern.
Im Historischen Lexikon der Schweiz wird der erste Antrag auf ein Frauenstimm- und Wahlrecht auf das Jahr 1868 datiert. Zwei Zürcherinnen verlangten damals anlässlich der kantonalen Verfassungsrevision das aktive und passive Wahlrecht. Vergebens. Es folgte ein hundertjähriger Kampf, bis die Frauen in der Schweiz wählen und abstimmen durften. Am 7. Februar 1971 nahmen die schweizerischen Männer das eidgenössische Stimm- und Wahlrecht für Frauen mit 65,7 Prozent Ja-Stimmen an. Manche Gemeinden verzögerten die Einführung des Frauenstimmrechts bis in die 1980er Jahre. In Appenzell Ausserrhoden konnten sich die Männer erst 1989 zur Annahme des Frauenstimmrechts durchringen und in Appenzell Innerrhoden wurde es erst 1990 nach bundesgerichtlichem Entscheid eingeführt. Im globalen Vergleich steht die Schweiz mit der Einführung des Frauenstimmrechts auf einem der hintersten Plätze.
Ankämpfen gegen Bruder, Vater und Sohn
Die Historikerin Franziska Rogger sieht den Grund für diese Verspätung im politischen System der Schweiz. Die direkte Demokratie sieht vor, dass Verfassungsänderungen nur mit einer Volksabstimmung erreicht werden können. Anders als in anderen Ländern, wo das Wahlrecht durch ein Parlament, einen Minister*innenrat oder ein Staatsoberhaupt von oben eingeführt werden konnte, bedeutete das, dass die Stimmrechtlerinnen in der Schweiz die Mehrheit der Schweizer Männer von ihrem Anliegen überzeugen mussten. Es galt also «gegen die Brüder, Väter, Söhne anzugehen, die man doch liebte, denen man vertraute, deren Urteilen die Frauen gewohnt waren nachzuleben.» (S.32)
Es ging also darum Strategien herauszufinden, mit denen man auch konservative Männer «bewegen, aufschrecken, zermürben oder überlisten» konnte. (S.31) Doch der entscheidende Gesinnungswandel erfolgte erst durch Druck von aussen: Als die Schweizer Männer 1969 die europäischen Menschenrechtskonventionen unterzeichnen wollten, hätten sie dies nur «mit Vorbehalt» tun können, denn die Konvention fragte nach gleichen Rechten für Männer und Frauen. «Viele männliche Prominenz war geneigt, mit Vorbehalt zu unterzeichnen.» (S.32) Doch die Frauenrechtlerinnen protestierten lautstark: «Keine Menschenrechte ohne Frauenrechte.» (S.32) So endete die 3. Abstimmung zum Frauenstimm- und Wahlrecht am 7. Februar 1971 endlich positiv.
Wie bringt man Menschen dazu, ihre Privilegien abzugeben oder mit anderen zu teilen? Das beschäftigt auch Lotta Suter, die Mitbegründerin der WOZ. Im Vergleich des Frauenstimmrechtskampfes in der Schweiz mit der Bürgerrechtsbewegung in den USA kommt sie zum Fazit, dass die Mächtigen in allen Demokratien dafür gesorgt hätten, «dass sie die Herrschaft nicht mit allzu viel Volk teilen mussten. Zum Beispiel mit Besitzlosen. Mit Frauen. Mit Aborigines oder Inuit. Mit ehemaligen Sklaven. Mit Menschen anderer Hautfarbe oder Religion.» (S.45-46) Die Liste der Ausgeschlossenen sei lang. Und deshalb gibt sie sich auch mit dem Frauenstimmrecht noch lange nicht zufrieden. Sie fordert stattdessen «politische Rechte für alle Menschen, die in der Schweiz leben und arbeiten und Steuern zahlen, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus.»
Vor dem Mitspracherecht
Berührende Einblicke in das Leben einer Frau vor der Annahme des Frauenstimmrechts gewährt die Kurzgeschichte «Späth-Sommer 1959» von der 1940 geborenen Lehrerin und Journalistin Angelika Waldis. Die Protagonistin ihrer Geschichte, Ehefrau eines Theo Späths, träumt von einer Zweizimmerwohnung in einer grossen Stadt, die sie selbst einrichten kann. Ausserdem würde sie gerne eine Bürostelle übernehmen, doch Theo findet nicht, dass sie arbeiten muss. Und wenn sie ihrem Sohn Beat ein Paket schicken will, hat sie Theo um Geld zu bitten. «Muss das sein?», fragt dieser dann jeweils.
Die Geschichte beschreibt eine Lebensrealität des Fremdbestimmt- und Abhängig-Seins, die für viele verheiratete Frauen in der Schweiz noch bis 1988 galt. Dies offenbart der Text der Historikerin Elisabeth Joris. Denn auch wenn die Frauen seit 1971 wählen und abstimmen durften, standen verheiratete Frauen noch bis zum Inkrafttreten des neuen Eherechts am 1. Januar 1988 unter der Vormundschaft ihres Ehemannes. Mitte der achtziger Jahre stimmte immer noch die Mehrheit der Männer gegen das neue Eherecht, doch dank der mittlerweile stimmberechtigten Frauen wurde es schliesslich angenommen. Somit war «das Ja für das neue Eherecht […] ein Sieg der Frauen», konstatiert Joris.
Kein Wundermittel
Das Frauenstimm- und Wahlrecht stellte für die Schweizerinnen einen grundlegenden Schritt in Richtung Mitbestimmung und damit auch in Richtung Selbstbestimmung dar. Doch das Frauenstimmrecht war kein Wundermittel zur Heilung aller Ungerechtigkeiten im Geschlechterverhältnis. Das verdeutlichen beispielsweise die erschreckend tiefen Zahlen von Frauen in der Schweizer Politik, mit welchen die Historikerin und Geschlechterforscherin Fabienne Amlinger für die Einführung von Frauenquoten plädiert. Das offenbaren aber auch die von Simona Isler und Anja Peter thematisierten jährlichen 5,6 Milliarden geleisteten und unbezahlten Stunden Haus-, Erziehungs- und Care-Arbeit von Frauen. Die beiden Historikerinnen, Mütter und Hausfrauen verlangen deshalb «Lohn für Hausarbeit», «Lohn für alle Frauen» und «Lohn für alle Arbeit». (S.171) Und das zeigt ebenso der Essay von Anna Rosenwasser, Geschäftsleiterin der Lesbenorganisation Schweiz, der darlegt, wie «die Identität lesbischer Frauen erst dann anerkannt [wird], wenn sie für die männliche Lust instrumentalisiert werden kann.» (148) Lesben existieren in der Wahrnehmung oft nur als Pornokategorie. Ein typisches Beispiel für weibliche Unsichtbarmachung, meint Rosenwasser.
Besonders aus dem Herzen spricht der jungen Leserinnenseele der Text der Spoken-Word-Poetin Fatima Moumouni. Sie hat einen Freund gefragt, was er an seinem Körper verändern würde, wenn er könnte. Seine Antwort nach gewissenhaftem Nachdenken: «Vielleicht würde ich etwas an der Explosivität meiner Muskelkraft verändern, dann könnte ich höher springen. Oder stabilere Knöchel, die verknackse ich mir immer so schnell.» (S.199) Seine Antwort lässt nicht nur die Autorin perplex zurück. Völlig unvermittelt offenbart er mit seiner unschuldigen Reaktion das Ausmass geschlechtlicher Sozialisation: Während x Generationen von Frauen und Mädchen auf ein attraktives Äusseres konditioniert wurden, ist es für den jungen Mann selbstverständlich, von der Optimierung seiner Leistungsfähigkeit zu träumen.
Aufschreiben und Erinnern
Mit den Worten Moumounis: «Das Patriarchat verschwindet nicht mit dem Stimmrecht. Es verschwindet überhaupt nicht allein mit rechtlichen Anpassungen.» (S.194) Das Patriarchat aus dem Kopf zu bekommen, das bedeutet noch ganz viel bevorstehende Veränderung, und das wiederum bedeutet noch ganz viel Kämpfen. Oder um es im Kochjargon des Buches auszudrücken: Es gibt Gerichte, die eine enorme Vorbereitungszeit brauchen. Und wenn sie dann endlich auf dem Tisch sind, stillen sie den Hunger doch nicht. Ein solches Gericht ist das Frauenstimm- und Wahlrecht in der Schweiz. Hundert Jahre mussten die Aktivist*innen für dessen Einführung kämpfen. Und nun zeigt sich nach fünfzig Jahren Frauenstimmrecht, dass es auf dem Weg in eine Gesellschaft gleichgestellter Frauen und Männer noch viel zu tun gibt.
Und das bedeutet auch Frauengeschichte schreiben. Auch aufschreiben. Heldinnen und Pionierinnen, aber auch weibliche Lebensrealitäten und Innenwelten gab es schon immer. Nur wurden sie nicht erfasst, nicht sichtbar gemacht und schon gar nicht an sie erinnert. «Sie begleiten uns nicht mit aller Selbstverständlichkeit, ihre Stimmen sind nur allzu selten Schulmaterial, ihre Worte sind allzu selten ausgestellt in den Bibliotheken oder in Gespräche und Artikel eingewoben; es wird kaum auf sie Bezug genommen», um es in den Worten von Yael Inokai auszudrücken. Und genau deshalb soll dieses Buch gelesen werden.