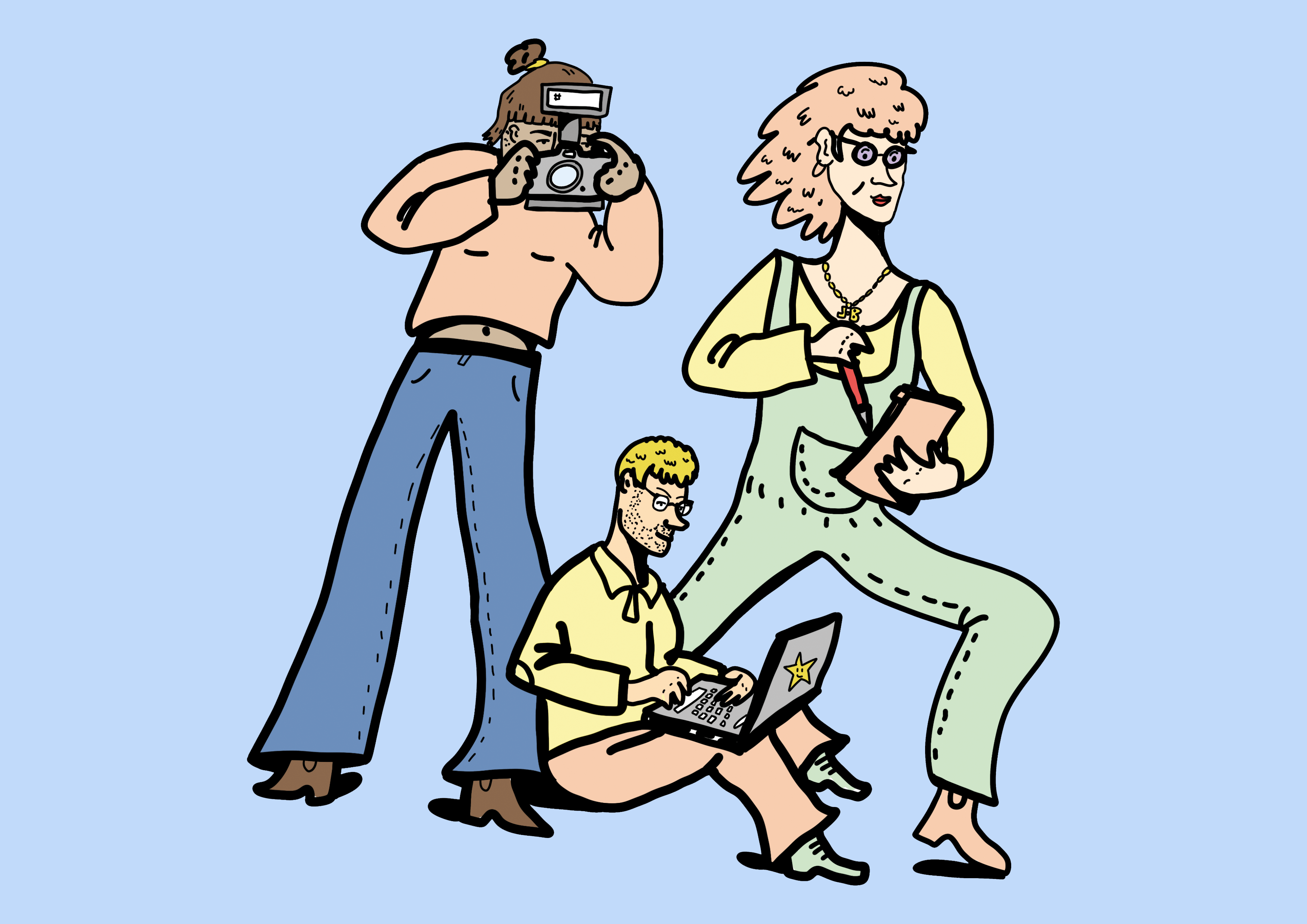Mit dem letzthin bekannt gegebenen «Projekt 2020» will der Tamediakonzern seine Printmedien rabiat gesundschrumpfen. Kommt das Gespräch in diesen Tagen auf den Medienplatz Bern, so ist man stets schnell bei der Frage: Warum stützt Tamedia die angeschlagenen Zeitungen nicht mittels Quersubventionierung, wenn er doch Jahr für Jahr Gewinne schreibt?
Die Frage wird auch öffentlich gestellt: Der ehemalige Tages-Anzeiger-Chefredaktor Peter Studer bedauerte letzthin auf Journal 21, dass Tamedia am «strikten Verbot der Quersubventionierung des journalistischen Ausbaus» festhalte. Die Gewerkschaft syndicom und der Berufsverband Impressum halten in der «Monopolzeitung» gemeinsam fest: «122 Millionen Franken: Kein Schweizer Medienkonzern erwirtschaftete 2016 mehr Gewinn als Tamedia. Für 2017 sieht es noch besser aus. Mit diesem Geld liessen sich innovative Medienprojekte finanzieren und die journalistische Qualität ausbauen. Stattdessen fliessen die Millionen in die Taschen der Aktionäre. Und die Tamedia-Redaktionen bekommen ein weiteres Abbauprogramm verschrieben.»
Zeitungsverlage im Kampf mit dem Inseraterückgang
Der Inseraterückgang wuchs bei den Tamedia-Zeitungen von minus 4 Prozent (2014) auf minus 12 Prozent im ersten halben Jahr 2017. Das ist alarmierend. Allerdings: Mit einem Bruchteil der 76,6 Millionen Franken Gewinn, die der Konzern für das erste halbe Jahr 2017 ausgewiesen hat, könnte er seine Printmedien vorderhand stabilisieren. Es würde der «führenden privaten Schweizer Mediengruppe» ja eigentlich gut anstehen, wenn sie auch im verlegerischen Interesse der Zeitungen geführt würde.
Zeitungen sind nie selbsttragend gewesen. Während des 20. Jahrhunderts bestanden Zeitungsverlage deshalb aus einer Redaktion, einer Abo- und einer Inserateabteilung: Die Redaktion machte die Zeitung, die anderen Abteilungen verdienten das Geld, mit dem der redaktionelle Teil quersubventioniert wurde.
Dieses Finanzierungsmodell wurde in den letzten Jahrzehnten prekärer. Kleine Zeitungsverlage wurden zur Aufgabe oder zur Fusion mit grösseren Verlagen gezwungen. Diese können den Inserateschwund bei den Zeitungen besser auffangen, weil sie ihr Geschäft diversifiziert haben. Tamedia zum Beispiel publiziert nicht nur Zeitungen und Zeitschriften, sondern betreibt Kleinanzeigenportale wie Homegate und mehrere Jobbörsen, verschiedene Marktplätze (Ricardo oder Tutti zum Beispiel) und Unternehmen wie Doodle, localsearch und zattoo.
Gefährdet Quersubventionierung die Unabhängigkeit?
Diese Onlineportale verdienen Geld, die Zeitungen verlieren Geld. Es ist nicht schwer zu sehen, was der Tamediakonzern gemacht hat: Er hat das Finanzierungsmodell für Zeitungen mit den Standbeinen Redaktion/Abonnemente und Inserateabteilung in zwei selbständige Geschäftsbereiche auseinandergebrochen. Seither konkurrenzieren die bedienungsfreundlichen und deshalb attraktiven Online-Werbefirmen das Inserategeschäft der konzerneigenen Printprodukte und gewinnen Jahr für Jahr Marktanteile.
Seit 2007, als Tamedia die Espace Media Group – und damit «Bund» und «Berner Zeitung» – übernahm, wird nach dieser Strategie verfahren. 2008 sagte Tamedia-Verwaltungsratspräsident Pietro Supino laut kleinreport auf die Frage, ob der Bund nicht quersubventioniert werden könnte, der Verwaltungsrat wolle, «dass jedes Medium zum wirtschaftlichen Erfolg der Gruppe beiträgt». Und vor einem Jahr sagte Tamedia-Sprecher Christoph Zimmer gegenüber der Medienwoche: «Auch für Tamedia stellt sich die Frage, ob die Zeitung eine eigenständige Perspektive auf die Region bieten kann und ob sie von dieser wirtschaftlich, sei es durch Abonnenten oder Inserate, getragen wird.» Auf die Nachfrage nach Quersubventionierung fügte Zimmer bei: «Das würde die Unabhängigkeit der Zeitungen gefährden.»
Ist die Pressevielfalt am Ende?
Auch beispielsweise der Ringier-Konzern wird immer mehr nach dieser Logik geführt. Ein Ringier-Journalist erinnert sich gegenüber Journal B an eine Mitgliederversammlung des Konzerns, an dem Verwaltungsratspräsident Michael Ringier die roten Zahlen des «Blicks» so kommentiert habe: «Jetzt wissen wir, wieso wir das gewinnbringende Vietnam- und Osteuropageschäft pflegen: Damit wir hier einigermassen normal weiterarbeiten können.» Diese Versammlung habe um 2005 stattgefunden. Vor wenigen Tagen nun hat Ringier-CEO Marc Walder in einem Interview dem «Handelsblatt» gesagt, wegen des Inserateschwunds stünden der Presse «die schwierigsten Jahre noch bevor». Quersubventionierungen durch andere Unternehmensbereiche hätten keinen Sinn: «Ich halte nichts von Quersubventionierung – ausser, Sie sind ein Mäzen. […] Es wird blutig werden. Kleine Verlage werden sich in die Arme von grösseren retten, einige Zeitungen werden nur noch jeden zweiten Tag erscheinen, andere werden schliessen. Die geniale Pressevielfalt, die wir hatten, wird unter die Räder kommen.»
Walders letzter Satz ist wichtig. Auf der Leitungsebene der Medienkonzerne steht die Pressevielfalt – die die Politik nach wie vor als Teil der vierten Gewalt sieht – offensichtlich vor dem Ende. Klar ist dabei, dass Konzerne wie Tamedia oder Ringier im Gegensatz zu kleinen Zeitungsverlagen den Spielraum hätten, etwas für das Weiterbestehen der Pressevielfalt zu tun. Andererseits ist auch klar: Der Auftrag des Managements eines Medienkonzerns lautet heute nicht, als Zeitungsverleger im Interesse der Zeitungen zu handeln. Er lautet, als Dienstleister der Sharholder die Dividenden zu optimieren. Trotzdem ist es wahr, dass die Verweigerung der Quersubventionierung die Zeitungen schwächt und auf die Dauer zum grossen Teil zerstört.
Für mich gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder macht Geldgier tatsächlich dumm und staatspolitisch kurzsichtig, oder die Geldgier der Shareholder ist der probate, unpolitisch scheinende Vorwand, um die Pressevielfalt vorsätzlich unter die Räder kommen zu lassen.
Vielleicht sollten die Demokratinnen und Demokraten im Land über diese zweite Möglichkeit einmal nachdenken.