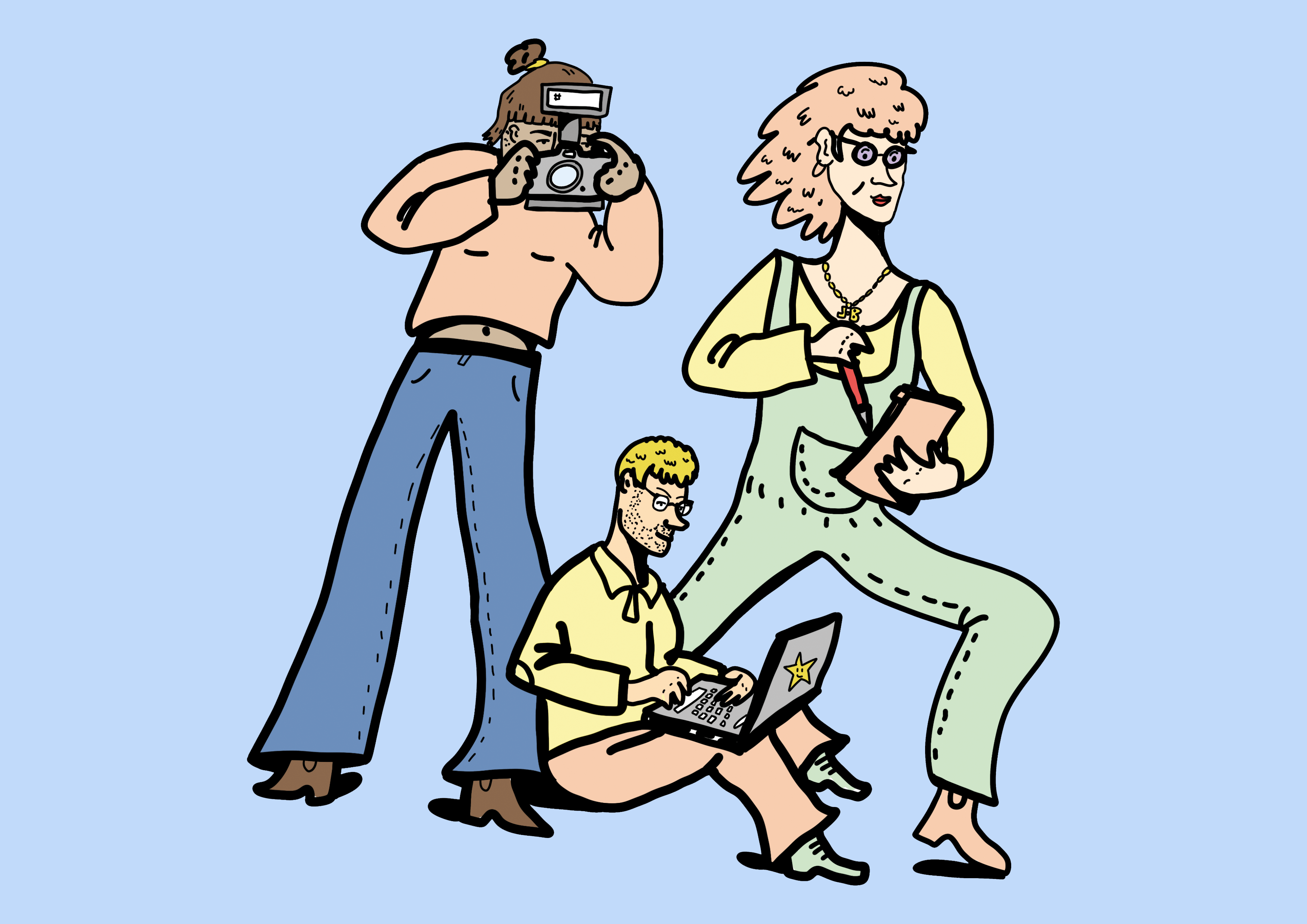Zu Bern: Sie haben uns die Frage, ob Bern trotz fehlender Industrialisierung überhaupt eine Stadt sei, noch nicht beantwortet. Ist Bern eine Stadt?
Es gibt drei Modelle von Städten in der Schweiz. Zürich wurde durch die Industrialisierung von einer Kleinstadt zu einem globalen Zentrum. Genf war schon immer eine wichtige und stolze Stadt. Bern ist eine eigenartige Mischung. Diese Stadt stand nie im Gegensatz zum Land, sondern lebte in einer Art symbiotischer Beziehung: Das Patriziat lebte vom Land, und wurde damit reich. Daher kam es nie zu einer starken Industrialisierung und der Ausbildung einer mächtigen Bourgeoisie.
Bis heute gehört der Burgergemeinde ein Drittel des Bodens in der Stadt. Die fehlende Urbanisierung ist also gesteuert.
Ich kenne mich in der Geschichte von Bern nicht gut aus. Aber die Burger sind zweifellos immer noch wichtig. Meine These wäre, dass es in Bern eine besondere innere Differenzierung gibt. Denn die grosse Mehrheit der Menschen gehört ja nicht zur Burgergemeinde. Das Ausgrenzen der «Reststadt» durch die Burgergemeinde führte offenbar dazu, dass sich «die Anderen» stärker organisieren und eine gewisse Offenheit entwickelten, die man in Bern gut spürt. Das macht Bern zu einem sehr angenehmen und auch einzigartigen Ort.
Gleichzeitig schildern Sie Bern als eine Stadt, die keine Urbanisierung im Sinne von Industrialisierung durchgemacht hat. Dann könnte die Stadt eigentlich auch keine Urbanität haben und wäre somit ein Kaff?
Ich persönlich fand die Menschen in Bern immer urbaner, offener und neugieriger als beispielsweise in Basel. Und es gab in Bern eine Urbanisierung über den Dienstleistungsbereich, die Verwaltung. Bern wurde zu einem Zentrum der nationalen und internationalen Politik und Kultur. Die meisten bundesnahen Betriebe sind in der Region Bern. Deshalb muss man Bern als Region und nicht als Stadt denken. Am ETH Studio Basel nennen wir diese Region den Städtekranz Bern. Von Bern aus ist man mit dem Zug in einer halben Stunde in Thun, Burgdorf, Solothurn, Biel, Neuenburg und Freiburg. Das ist eine unglaublich reichhaltige Region. In einer halben Stunde Zugfahrt ist man in Zürich noch nicht sehr weit. Aber von Bern aus sitzt man da bereits am Neuenburger See und isst Filet de Perche. Und Bern selbst hat auch seine Qualitäten. Die Länggasse und die Lorraine sind klein, aber haben städtischen Charakter. Und Bern hat seine Reitschule verteidigt. Basel zum Beispiel hat damals die Stadtgärtnerei verloren.
Arbeiten zum Nutzungskonzept für den «Unort» Schützenmatte haben begonnen. Bern Tourismus schlägt für das Areal ein Hochhaus mit einem Freibad auf dem Dach, Lounge und Gurlitt-Sammlung vor. Hat die Reitschule daneben noch Platz?
«Wenn man die Schützenmatte verbaut, dann opfert man die Reitschule. Dann schliesst man den urbanen Freiraum.»
Christian Schmid
Nein, wenn man die Schützenmatte verbaut, dann opfert man die Reitschule. Dann schliesst man den urbanen Freiraum. Es gibt zwei Feinde der städtischen Freiräume: Der Staat, der alles kontrollieren und reglementieren will. Diese Art von Intervention hat in den letzten Jahren in vielen Städten deutlich zugenommen. Der andere Feind ist der Markt, der die Räume kommerzialisiert. Das Städtische wird zu einer Ware. Es beginnt bereits bei den Strassencafés. Sie sind einerseits eine Bereicherung, aber wenn der Cappuccino sieben Franken kostet, schliesst dies viele Leute aus.Urbanität ist im Kern die Freiheit, sich ungezwungen, also nicht organisiert, zu begegnen. Stadt bietet gleichzeitig Anonymität und Kontaktmöglichkeiten. Im Dorf hat man weder das eine noch das andere. Man ist Teil des sozialen Verbandes, der Gemeinschaft, in der einem eine bestimmte soziale Rolle zugeschrieben wird. Man kann da kaum ausbrechen.
Es gibt soziale Kontrolle.
Ja. Gleichzeitig kann man nicht wirklich auf die Leute zugehen, weil die soziale Struktur vordefiniert ist. Man entkommt seiner Rolle nicht. In der Stadt kann man seine Lebensentwürfe selber gestalten. Wir nennen das eine konkrete Utopie, eine Utopie, die zwar realisiert werden kann, aber ein utopisches Moment hat, weil die Realität oft ganz anders ist. Damit die Utopie eine Chance hat, brauchen wir Räume, die die Freiheit zulassen. Die einfachste Art, solche öffentlichen Räume zu zerstören ist, teure Wohnungen hinzustellen. Die Bewohnerinnen und Bewohner von teuren Wohnungen intervenieren erfahrungsgemäss sehr schnell gegen alles, was auch nur irgendwie stören könnte – Musik, Leute auf der Strasse, Kinder…
In Bern haben wir eine solche Geschichte mit dem Sousol erlebt.
Ja genau, das ist der klassische Fall. Eine Frau zieht in ein Haus neben einem Club und beschwert sich nachher darüber, dass es einen Club hat. Das Beispiel ist zwar extrem, aber typisch. Zudem gibt es einen zweiten Prozess, für den gerade rotgrüne Stadtregierungen besonders anfällig sind. Sie wollen die Stadt flächendeckend schmücken und ausstaffieren und nett machen – das nennt man dann «Aufwertung», was ja bereits anzeigt, dass das Gebiet vorher offenbar nicht viel wert war. Die Regierungen und Behörden sind sich oft nicht bewusst, was sie damit anstellen. Überall braucht es verkehrsberuhigte Zonen, und überall sollen Familien mit Kindern wohnen können. Aber warum in aller Welt muss in Zürich eine Familie ausgerechnet ins Rotlichtmillieu an der Langstrasse ziehen?
Diese Politik, die Stadt überall gleich zu machen, ist demnach eine naive Antisegregation?
Ja, es ist letztlich eine antiurbane Politik. Denn «urban» heisst, dass es Unterschiede gibt und auch Orte, an denen es etwas unordentlich aussehen und auch etwas «strub» zu und her gehen kann.
Die Berner Innenstadt ist allerdings am Wochenende nachts nicht mehr sehr gemütlich. Werde ich alt oder verändert sich etwas?
Es verändert sich, und das hat mit der Konsumhaltung zu tun. Dabei darf man die Nachtverbindungen des öffentlichen Verkehrs am Wochenende nicht unterschätzen. Die Jugendlichen kommen aus der weiteren Umgebung und die Stadt wird zum Ballermann. Gerade für Jugendliche aus der Agglomeration ist die Stadt in diesem Sinn attraktiv. Gleichzeitig gibt es nur noch wenige Orte, wo Jugendliche einfach zusammen reden und abhängen können. Sie werden überall weggewiesen, denn es gibt praktisch keine konsumfreien Orte mehr, und überall beschweren sich Anwohner. Die jungen Leute haben immer weniger Freiräume und hängen dann halt in der Innenstadt herum.