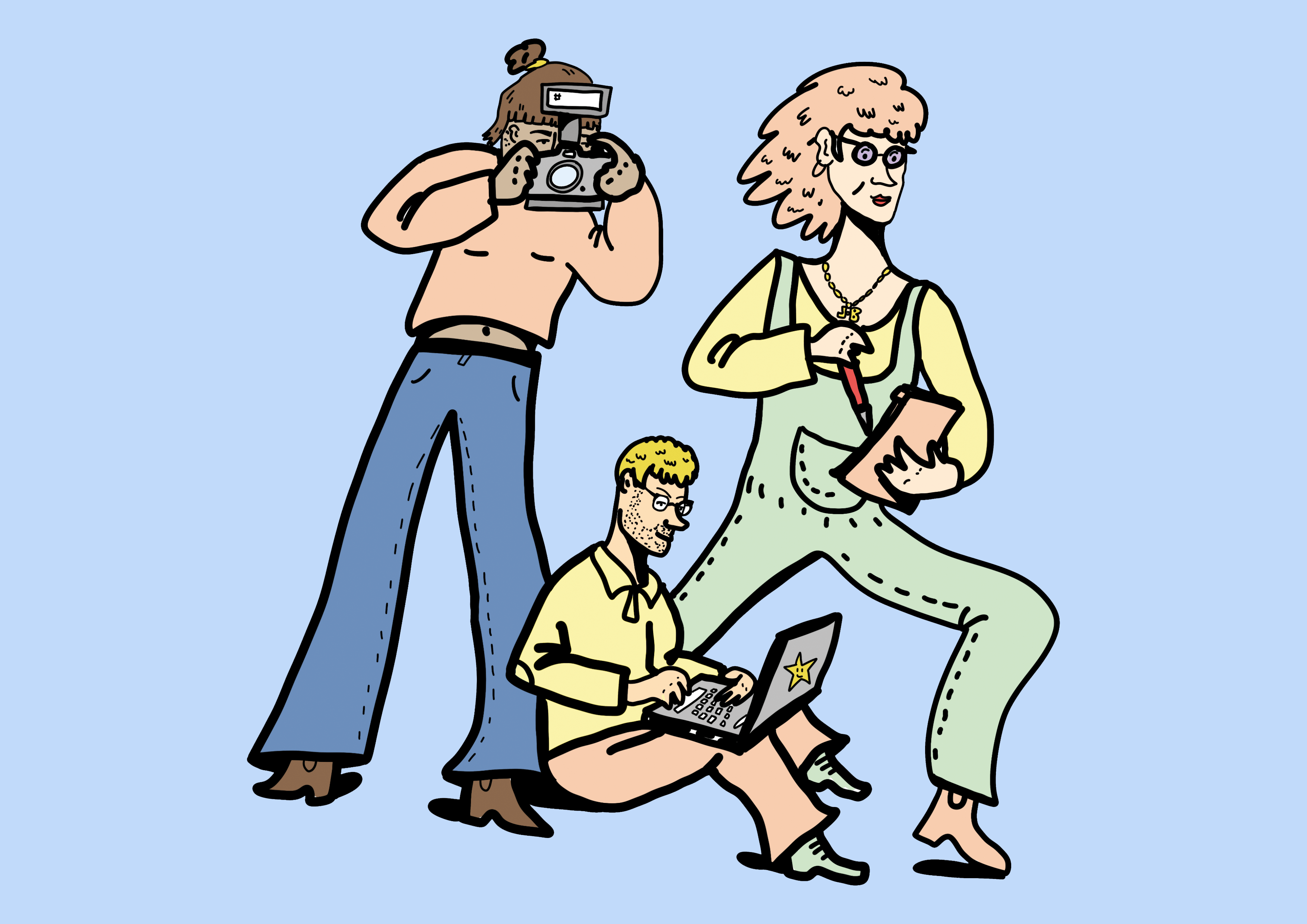Fünf Männer diskutierten unter Leitung einer Frau – Marta Kwiatkowski Schenk vom Gottlieb Duttweiler Institut in Rüschlikon – am dritten Podiumsgespräch im Kunstmuseum.
Ein Einziger wurde konkret. Auf die Schlussfrage der Moderatorin, was für ein künftiges Kunstmuseum es in Bern brauche, bezeichnete Stadtpräsident Alec von Graffenried das Louisiana Museum of Modern Art als sein Lieblingsmuseum. Es liegt in Humlebaek, eine halbe Zugstunde von Kopenhagen entfernt, an einem sanften Hang über dem Meer. Dort fühle er sich zu Hause. Damit konnte man sich vorstellen, was dem Stadtpräsidenten vorschwebt.
Dieses Bekenntnis war in der ansonsten recht abstrakten Diskussion wohltuend. Denn was bedeuten die von anderen Teilnehmern – ausschliesslich Männern, da die kranke Erziehungsdirektorin Christine Häsler durch Kulturamtschef Hansueli Glarner vertreten wurde – verwendeten Wörter wie «ikonischer Bau» oder «Kathedrale unserer Zeit»? Was heisst, man wünsche sich Licht, Tageslicht, keinen vor allem aus Treppenhäusern bestehenden Bau? Wie kann man dies verstehen, ohne dass Beispiele genannt werden? Und was ist ein Museum, in dem nicht die Objekte im Zentrum stehen, sondern die Menschen; wo gibt es ein solches aus neuerer Zeit?
Dazwischen
Im Verhältnis zu Susch im Unterengadin (Muzeum von Grazyna Kulczyk) und Bilbao (Frank Gehrys Guggenheim-Museum) sei Bern dazwischen, fand der Stadtpräsident gleich zu Beginn. In Bern seien die Kulturorte tief verwurzelt, die Aktivitäten entstünden von unten, landeten nicht von oben und von aussen. Zudem: Hier würden die Kunstsparten ineinander greifen, da sich die Trennung zwischen den Sparten immer mehr aufweiche und es in Bern auch starke Institutionen der darstellenden Künste gebe. Ein Museum müsse gut sein für die hiesige Bevölkerung, dann ziehe es auch Touristen an.
Jobst Wagner, Unternehmer und Präsident der Stiftung Kunsthalle, betont die Bedeutung des Biotops für ein Kunstmuseum: Künstlerinnen und Künstler, Sammlerinnen und Sammler, unterschiedlich ausgerichtete Häuser, private und öffentliche Partner. Eine Hauptaufgabe der öffentlichen Hand sei es, das kollektive Gedächtnis zu bewahren. Insgesamt gelte es zu fragen, was man in Bern habe, wolle und könne und wo die hiesige Besonderheit liege. Wagner weist darauf hin, dass 80% der Kunstwerke in den Sammlungen nie in Ausstellungen gezeigt werden, sondern ständig in den Depots verwahrt bleiben. Und er fragt nach dem Unterschied zwischen einem Museum, einer Kunsthalle und einem Kunstlabor.
Kunstvermittlung integriert
Für Hansueli Glarner spielt die Vermittlung von Kunst im Museum eine zentrale Rolle. Die Förderpolitik des Kantons setze hierfür auf die Jungen, primär in den Schulen, wo man alle Kreise der Bevölkerung erreiche. Es gehe darum, sich im Museum zu akklimatisieren und heimisch fühlen zu lernen, um Horizonterweiterung, Inspiration, Entdeckung des Möglichkeitssinns. Dafür brauche es unterschiedliche Module, professionell entwickelt, für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen (Kinder, Migrantinnen und Migranten, ein Fachpublikum). Das Museum der Zukunft solle die Menschen «hineinsaugen» und ins Zentrum stellen, nicht die Objekte,
Alec von Graffenried betont die Integration als Zweck der Kulturvermittlung. Kulturelle Stimulation sei wichtig in einer Wissensgesellschaft, die sich rasch verändert.
Der ehemalige Geschäftsmann, Botschafter in China und Sammler chinesischer Kunst Uli Sigg ist der Auffassung, die fortschreitende Digitalisierung könne ein physisches Museum nicht ersetzen: Das Massstäbliche der Werke, die Erlebbarkeit des Sublimen benötigten den Zugang zu den realen Objekten. Wichtig sei ein Ort, «wo die Dinge ruhen». Zumindest vorderhand brauche es beides, das Physische und das Digitale.
Digitalisierung greift tief ein
Jörg Schulze (von der Agentur Maze für digitale Projekte, unter anderem mit Museen) erklärt, alles Digitale gehe von einem analogen Ort und Kunstbestand aus und erweitere die beiden. Vor der Digitalisierung von Kunstwerken stelle sich die Frage, was man mit den digitalen Werken anstrebe, wie man mit ihnen arbeiten wolle. Denn Digitalisierung sei teuer, benötige viele Ressourcen und greife tief in Strukturen und Arbeitsprozesse eines Museums ein. Ein Problem sei etwa, dass vielenorts die KuratorInnen die inhaltliche Hoheit haben und die KunstvermittlerInnen ihnen nicht gleichgestellt sind. Beachten müsse man, dass digitale Zyklen 2-3 Jahre lang sind, viel kürzer als Planung und Ausführung eines Bauvorhabens. Wichtig sei, so Schulze, Eventräume zu planen, um Möglichkeiten für noch Unvorhersehbares zu schaffen.
Alec von Graffenried findet Flexibilität die wichtigste bauliche Eigenschaft: frei einteilbare, anpassungsfähige Räume. Auf Frage der Moderatorin schliesst er einen temporären Bau nicht aus, gibt aber zu bedenken, die Anforderung an einen Aufbewahrungsort für Kunst (Wagners «kollektives Gedächtnis») verlange Dauer.
Glarner ist überzeugt: Je besser die digitale Vermittlung, desto wichtiger wird das Museum als Ort, wo sich Menschen treffen, miteinander diskutieren.
Wo sind wir stark?
Dafür sei das Museum als Netzwerk geeignet, mein Stadtpräsident Alec von Graffenried. Er bestätigt – wie zuvor Uli Sigg – die Bedürftigkeit der Menschen, etwas gemeinsam zu erleben. Deshalb findet er Digitalisierung eine sinnvolle Erweiterung, aber keinen Ersatz des Analogen.
Zur Diskussion gestellt werden die konservatorischen Anforderungen an die Ausstellungsräume (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Begrenzung der direkten Lichteinstrahlung usw.), die für nur vorübergehende Platzierung von Kunstwerken hoch seien und Manches ausschlössen. In diesem Sinn sei die Frage der Depots neu zu betrachten, etwa im Sinne von Schaulagern.
Später erwähnt Jobst Wagner nochmals die Bedeutung des Biotops, in das hinein der Erweiterungsbau konzipiert wird. Er nennt als Stärken des Standorts die hochwertigen Sammlungen, die Existenz des Zentrums Paul Klee, die Kunsthalle (der Stadtpräsident ergänzt: die Nachbarschaft des PROGR als Zentrum für Kulturproduktion). Zu bedenken sei jedoch auch: Der Kanton Bern als grösster Nettoempfänger des Finanzausgleichs sei nicht unternehmerfreundlich, und offen bleibe, woher er zusätzliche Einnahmen erzielen könne. Zudem müssten die Folgekosten einer Museumserweiterung bedacht werden, für baulichen Unterhalt und für den Vermittlungs- und Kunstbetrieb. Und auch jegliche Digitalisierung koste. Es war insgesamt ein kleiner Exkurs in die Realität der Politik und deren Beziehung zur Spendefreudigkeit der Wirtschaft.
Wofür genau?
Nun kommt das Publikum zum Zug. Thomas Pfister wünscht im Neubau mehr Licht, mehr Raum, mehr Kunst; er wünscht viele intime Kunstkapellen und eine Art offenen Kreuzgang. Jemand nennt das Schaulager in Basel als Beispiel (in kleinerem Formal) oder die Kunsthalle Mannheim; auf jeden Fall sei das «Heiligtum» der Depots zu «entweihen». Carola Ertle Ketterer plädiert für Belebung der Hodlerstrasse und Verlegung des Verkehrs; wichtig sei auch die Öffnung der Fassade des Kunstmuseums zum PROGR hin. Als letzter Votant aus dem Publikum stellt Christian Jaquet die Gretchenfrage: Wofür genau braucht das Kunstmuseum mehr Raum, wie will es diesen nutzen? Dazu erprobt er selbst die Antwort, indem er den in Bern gross gewordenen heute in Basel wirkenden Josef Helfenstein rühmt, der die Sammlung pflege und sich um die lokale Kunst kümmere.
In der Schlussrunde der Podiumsteilnehmer mahnt Jobst Wagner, Bern müsse seine Stärken beachten, authentisch bleiben, auf die Kosten schauen. Schulze ist klar: Das Digitale kommt, man muss bereit sein, damit umzugehen. Sigg plädiert für einen völlig offenen, ikonenhaften Bau, denn niemand könne wissen, wie man in 30 Jahren Kunst konsumiere. Für Glarner muss das künftige Museum den kulturellen Boden festigen, das Vertrauen der Stadtberner Bevölkerung in die Kulturförderung rechtfertigen (er verweist auf die jüngsten Abstimmungsergebnisse) aber auch die vielfältigen Regionen des Kantons überzeugen. Alec von Graffenried schwärmt, wie erwähnt, vom Louisiana Museum of Modern Art am dänischen Öresund. Und wir im Publikum können uns individuell ausmalen, wie das werden könnte in Bern; mit einem Skulpturengarten vor dem Museum, einem Weg hinunter zur Aare, mit Neubauten im Stil von Pavillons. Plötzlich erscheint Vieles möglich.
Treffpunkt 10. September
Die Reihe der Podiumsgespräche ist damit abgeschlossen. Im Kunstmuseum wird an der Entwicklung der Entscheiddossiers weiter gearbeitet. Am 10. September werden die Ergebnisse öffentlich präsentiert. Dann wird man sehen, welche Schlüsse aus den zahlreichen, weit auseinanderdriftenden Überlegungen gezogen worden sind und mit welchen Anforderungen der Architekturwettbewerb lanciert werden soll.