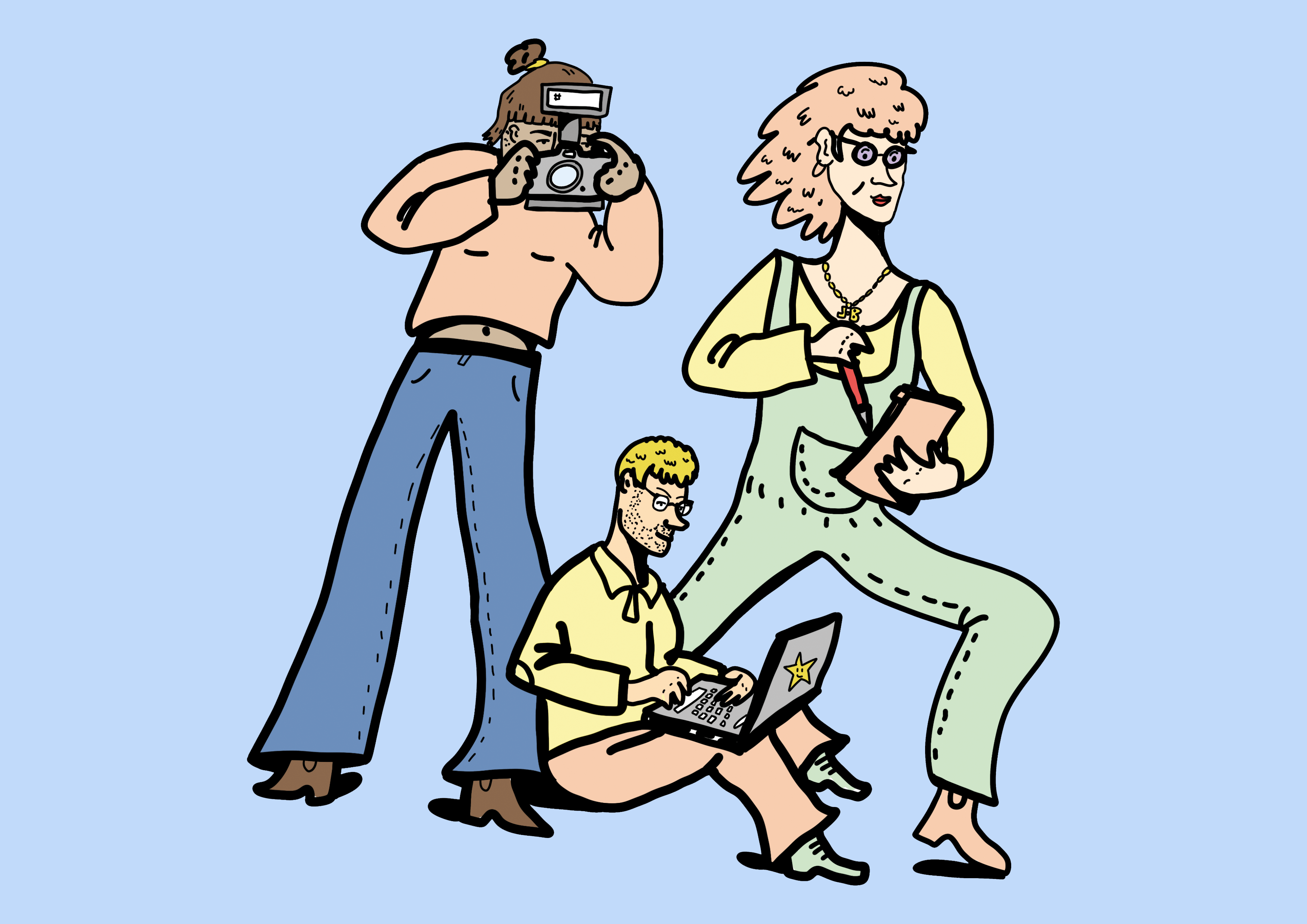Was hat dich zu dieser Arbeit veranlasst?
Miriam Sturzenegger:
Ausgangspunkt für dieses gemeinsam mit einem Komponisten und einer weiteren Künstlerin entwickelte Projekt war das merkwürdige architektonisch-soziale Gefüge der Kunsthalle Luzern innerhalb des runden Bourbaki-Panorama-Gebäudes. Der schlauchartige Raum der Kunsthalle ist durch eine gewaltige Glasfront von der foyerartigen Eingangshalle des Bourbaki getrennt und hat den Charakter einer riesigen Vitrine. Das Foyer ist eine Art halböffentlicher Raum, dient als Durchgangsbereich zu den Kinos im Untergeschoss, zur Stadtbibliothek und zum Panoramagemälde in den oberen Geschossen. Es gehört zum Bourbaki-Bistro und ist möbliert mit allerlei Sitzgelegenheiten, man kann sich da aber auch aufhalten, ohne etwas zu konsumieren.
Interessanterweise hat man von aussen einen besseren Blick in die Kunsthalle, als wenn man drin ist, und als AusstellungsbesucherIn beobachtet man unweigerlich die Leute, die auf der anderen Seite des Glases an den Tischen sitzen. Viele Leute blicken in die Kunsthalle, ohne jemals hinein zu gehen oder überhaupt zu wissen, um was für einen Ort es sich handelt. Das Schaufenster erzeugt eine doppelte, beidseitige Situation von Ausgestelltsein, aber als dichte akustische Barriere auch eine soziale Trennung.
Mit dieser Situation wollten wir arbeiten. So stellten wir schliesslich 50 PerformerInnen in den hell erleuchteten Raum der Kunsthalle, die einen ganzen Abend lang dort nicht viel mehr taten, als zu stehen, mal einen Arm zu heben, mal an die Scheibe zu treten und die Hand aufs Glas zu legen, mal die Arme zu verschränken oder (unhörbar) jemanden draussen anzusprechen. Man sah diese Menge von Leuten jeglichen Alters, die nichts taten, was einen offensichtlichen Sinn ergab: Sie sprachen nicht untereinander, sie machten kein Yoga, lauschten keiner Führung, hatten keine Versammlung und präsentierten kein Theater. Das wirkte auf das zufällige Laufpublikum und die Bistrogäste draussen sehr verwirrend: Leute waren da ausgestellt und taten «nichts». Es gab dieses vertraute Moment des Schaufensters, aber mit verkehrten Rollen. Es war dieses Herstellen einer leicht verschobenen Situation, diese Irritation, die mich interessiert hat.
Welchen Raum brauchst Du für deine Kunst?
Mehrheitlich arbeite ich installativ-skulptural, oft auch situativ, das heisst, der Raum, in dem ich eine Arbeit realisiere oder zeige, wird zu einem wesentlichen Teil der Arbeit und ist nicht einfach austauschbar. Der Raum ist etwas zwischen Untergrund, Rahmenbedingung, Material und Spiegel, bestimmt von architektonischen, zeitlichen, sozialen, funktionalen Ordnungen. Ich brauche keinen idealen oder neutralen Raum, sondern einen Raum, der mich dazu herausfordert, ihn durch meinen Eingriff oder Einschub selbst in den Blick zu rücken und gewissermassen zu «renovieren».
Sind gesellschaftliche Fragen Thema deiner Kunst?
Die gebauten Räume sehe ich als Bühnen unserer Wahrnehmung und Bewegung, aber auch als Raster, das unsere Aufmerksamkeit und Erwartungen bestimmt. Wie wir mit Information, Überforderung und mit Leere umgehen, mit Nichtwissen, sind Themen, die meine Arbeit begleiten. Kann ich dem Verlangen nach Information etwas anderes entgegensetzen – eine Situation, die mich physisch betrifft, aber sich der Benennbarkeit entzieht? Die Verschiebung von Aufmerksamkeit und den damit verbundenen Zeiterfahrungen und Wertzuschreibungen spielt in meiner Arbeit häufig eine Rolle.
Suchst du die Öffentlichkeit?
Öffentlichkeit bietet einer Arbeit Widerstand, den ich wichtig finde. Ich bin zusätzlich mit einem Kontext ausserhalb der Arbeit konfrontiert, aber es kommt auch der Moment des Nichtkalkulierbaren ins Spiel. Die Arbeit wird so für mich wie auch für andere zu einem Werkzeug, zu einer ebenso realen wie modellhaften Situation, die mir ermöglicht, etwas zu untersuchen oder zu erfahren. Ich will ja nicht einfach für die Schublade arbeiten. Öffentlichkeit kommt aber schon vor einer Ausstellungssituation ins Spiel, etwa wenn ich selber Materialtransporte mache – vor ein paar Wochen habe ich Bauprofile im Bus transportiert – oder wenn ich, wie im vergangenen Sommer bei Raum No. in der Berner Gerechtigkeitsgasse, im hell erleuchteten Erdgeschoss nachts bei geöffneten Fenstern arbeite und durchs Fenster angesprochen werde. Solche Momente von Durchlässigkeit schätze ich.
Wo siehst Du Potential zur Nutzung des öffentlichen Raums?
Während Umbau- oder Umnutzungsprozessen, wenn Orte neu definiert werden, gibt es die Zwischenphasen, in denen sich eine Lücke auftut oder etwas Seltenes entsteht: «leerer» Raum. Für einen befristeten Zeitraum können wir einen Raum anders sehen und betreten, neu denken als einen Ort von Handlung, deren Zweck nicht definiert ist. Vorübergehend aus dem Zonenplan ausbrechen, weder privat noch geschäftlich sein, sondern untersuchen, wie man sich in einem Raum bewegen könnte. Städtischen Raum als Bühne, als Labor verstehen, ohne ihn zum Eigentum zu erklären, das schwebt mir vor.