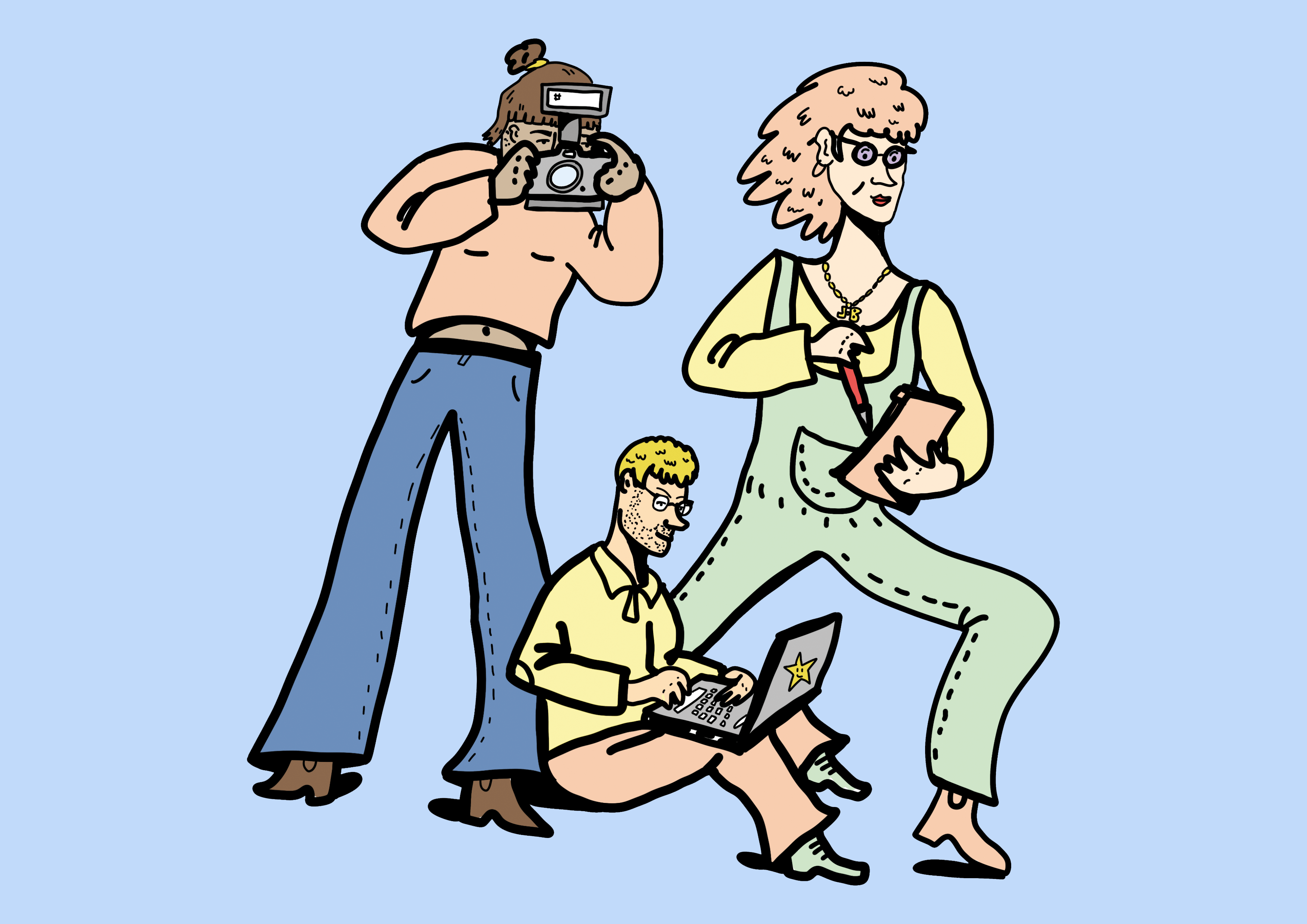Sie sitzen am Donnerstag der letzten Ferienwoche an einem gelbgrünen Klapptischchen im Innenhof des Zentrums Wittigkofen, beobachten am verregneten Nachmittag das Geschehen und erwarten Quartierbewohnerinnen und -bewohner, die sie befragen können. Sie, das sind Reto Bärtsch, für den Stadtteil 4 allein zuständiger Quartierarbeiter, und Jana Obermeyer, die aus dem Stadtteil 3 mithilft.
Ihre Aufgabe: Im Quartier Wittigkofen – mit seinen Schulen, dem Quartierzentrum und der Kulturarena vor vierzig Jahren entstanden, autofrei und familienfreundlich – die Zufriedenheit der dort Lebenden zu erfassen und einen allfälligen Bedarf an Quartierarbeit sowie an Räumen (innen wie aussen) zu erheben. Dazu dient ein ausführlicher Bogen. (Fragen sind etwa «Was ist ihr Lieblingsort in Wittigkofen?» oder «Gibt es einen Ort in Wittigkofen, an dem sie sich nicht wohlfühlen; wo?»)
Den Specht nicht vergessen
Zur Einordnung hilft ein standardisierter Beobachtungsbogen, in den die beiden ihre Eindrücke am Ort, etwa einen hämmernden Specht oder einen allein dasitzenden älteren Mann, festhalten. So entsteht das Bild eines Ortes aus dem Puzzle zahlreicher möglichst objektiver Feststellungen. Das Bild ist der Hintergrund oder besser das Umfeld der aus den Fragebogen gewonnenen subjektiven Aussagen der Bewohnerinnen und Bewohner.
Warum die Befragung? Im Wittigkofen-Quartier zeichnen sich Veränderungen ab. Da es viele «Alteingesessene» hat, deren Kinder flügge wurden, und viele neu zuziehen, zählt das Quartier heute etwa gleich viele unter 24-Jährige wie Leute ab 65 Jahren. Für viele ist die französischsprachige Schule und die Autofreiheit des Quartiers ein Grund herzuziehen.
Es gibt aber auch strukturelle Änderungen. Die Kirche muss bei ihren Räumlichkeiten sparen, es kann sein, dass sie diese abgibt. Aktuell ist deren Miete für private und öffentliche Nutzungen gestiegen. Die Bedeutung der Schulen und des (Einkaufs-)Zentrums für das Quartier ist nochmals gewachsen. Wobei auch das Zentrum seit Jahren Mühe bekundet, Nachmieter für die leerstehenden Räumlichkeiten im ersten Stock zu finden.
Verstehen wollen
In dieser Lage versuchen Reto Bärtsch und Jana Obermeyer zu verstehen, wie es den Leuten in Wittigkofen geht, was sie gut finden, was sie brauchen. Die Erkundung hat Anfang Sommerferien begonnen und soll Ende September enden. Einbezogen wird, wer sich befragen lässt. Jana Obermeyer und Reto Bärtsch gehen auf die Menschen zu, aber es gibt auch einen Online-Fragebogen. Mindestens einmal wöchentlich stellen sie ihr Tischchen auf, sprechen Leute an, wollen wissen. Zwei Frauen mit arabischer Herkunft helfen, den Kontakt zu erleichtern mit Zugewanderten, die wenig Deutsch verstehen.
Weiter geplant ist eine Reihe von Interviews mit Schlüsselpersonen: mit dem Schulleiter, mit freiwillig Engagierten, Vertreterinnen des Quartiervereins oder der Kulturarena. Daraus entsteht ein Porträt der Menschen und des Quartiers. Daraus wird womöglich eine Ausstellung in den kirchlichen Räumen, sozusagen ein Spiegel der teilnehmenden Beobachtung. Vielleicht gibt es auch eine Publikation, man wird sehen.
Eines scheint schon klar: Die allermeisten Menschen leben gerne hier und möchten bleiben. Zwar fahren viele in den grossen Ferien weg, besuchen Familie und Verwandte an ihrem Herkunftsort, weit weg. Aber sie kehren auch gern wieder zurück. Und lassen sich befragen.
Die Quartierarbeit
Aber wer sind die Befrager? Jana Obermeyer, aus Deutschland gekommen, ist Sozialgeographin mit Interesse an Quartierentwicklung. Sie hat einen Praktikumsplatz als Quartierarbeiterin im Stadtteil 3 gefunden und kann nun eine Kollegin im Mutterschaftsurlaub vertreten.
Reto Bärtsch, gelernter Polymechaniker, studierte Soziale Arbeit nach Praktika in der psychiatrischen Klinik Waldau, bei Insieme und PlusSport. Er war dann sieben Jahre in der offenen Kinder- und Jugendarbeit tätig, bevor er 2013 in die Quartierarbeit wechselte, um es mit Menschen aller Altersstufen zu tun zu haben. Nun ist er allein zuständig für das Kirchenfeld und die Schosshalde, auch Wittigkofen, ein grosses Gebiet mit unterschiedlichen Quartieren, das von der Autobahn durchschnitten wird, und das im Nordosten in idyllische Wiesen und Felder ausläuft, die an die Gemeinden Ostermundigen und Muri-Gümligen grenzen. Die Badi Ostermundigen gehört zum Naherholungsgebiet der Wittikofer, sie liegt näher als das Wylerbad und die Aare.
Hineinzukommen braucht Zeit
Bärtsch lebt mit seiner Familie in Bümpliz. Er nähert sich «seinem» Stadtteil behutsam an, taucht in ihn ein, erlebt ihn mit den Menschen. Er hat nicht das Gefühl, intervenieren zu müssen. Eher stützt er die Bewohnerinnen und Bewohner und ihre Strukturen und hilft mit bei Veränderungen, die sie wollen. Als er angestellt wurde, 2013, fragte ihn sein Vorgesetzter, wieviel Zeit er benötige, bis er «drin» sei, die Menschen verstehe, ihre Netzwerke kenne. Ein Jahr, dachte Bärtsch, brauche er wohl. Drei bis vier Jahre dauere es, antwortete ihm der erfahrene Ältere.
Quartierarbeit ist für beide ein Traumjob auf Dauer. Sich auf ein Quartier einzulassen mache nur Sinn, wenn man es lange mache, wie in einer Beziehung. Sich einzulassen, verändere einen selber. Immer sei man beides: beobachtend und beteiligt, Scharnier zwischen innen und aussen, Katalysator von Entwicklungen, die man mitgestalte. Die Gestaltungsmöglichkeit sei riesig. Allerdings dürfe man nicht meinen, man könne einfach nach Lust und Laune Dinge anpacken. Denn einerseits müsse man gegenüber dem Arbeitgeber, der VBG, begründen, was man tue. Andererseits sei man den Menschen im Quartier verpflichtet. So gross wie die Freiheit sei folglich die Verantwortung. Diese drücke manchmal, denn oft sei man in seiner Arbeit allein. Zunehmend arbeiteten deshalb die Quartierarbeiter der sechs Stadtteile themenbezogen zusammen und tauschten sich aus. Die regelmässig überarbeiteten Stadtteilberichte seien Informationsquellen auch für die Kolleginnen und Kollegen.
Initiative im Burgfeld
Das Beispiel einer freiwillig angepackten Aufgabe kommt zur Sprache. Im Burgfeld initiierte Reto Bärtsch für den Umbau des Gemeindehauses in eine Schule eine Mitwirkung des Quartiers schon bevor ein Vorprojekt vorlag. Erstmalig. So konnte zwar nicht das Äussere des Baus, aber dessen Raumaufteilung massgeblich mitbestimmt werden. Dies verhalf dem anfangs umstrittenen Bau zur Akzeptanz im Quartier. Die frühe Mitwirkung könnte auch andernorts Schule machen.
Allerdings: So etwas anzugehen, braucht Mut und Durchhaltewillen. Nicht alle begegnen den Quartierarbeitern mit Verständnis, nicht alle glauben, durch eigenen Einsatz etwas bewirken zu können. Wie man sich verhält, wie man redet, ist wichtig. Je nach Alter kommt man bei den Leuten unterschiedlich an. Wobei «ankommen» auch heissen kann, der Abfallkübel zu sein, in den Einzelne alles abladen, was ihnen widerfahren ist und missfallen hat. Man muss persönlich sein, ohne alles persönlich zu nehmen.
Idee eines neuen Labels
Eine persönliche Idee möchte Reto Bärtsch verwirklichen: Ähnlich dem Minergie-Standard ein Label zu entwickeln für kinderfreundliche und familiengerechte Siedlungen, das als Anreiz für gute und nachhaltige Überbauungen der Investoren dienen würde. Das Credo: Partizipation macht gute Architektur. Das umzusetzen ist schwieriger als im Fall der Minergie, denn soziokulturelle und architektonische Qualität lassen sich nicht in Formeln giessen und mit Zahlen messen. Aber den Versuch wäre es wert.
2 sind mehr als 1 und 1
Versucht man abschliessend zu erfassen, worum es bei Quartierarbeit geht und welches Repertoire an Eigenschaften, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Erfahrungen gefordert ist, versucht man sich dies alles vorzustellen – dann fällt es schwer zu verstehen, dass in einem Gebiet wie dem Kirchfeld-Schosshalde dafür nur eine einzige Person zuständig ist. Eine Person mit einem Büro ohne Öffnungszeiten, dafür einem gemieteten Cargobike, auf dem die nötigsten Utensilien, das gelbgrüne Tischchen und ein paar Klappsitzli ständig an neue Einsatzorte kutschiert werden. Es wäre kein Luxus, eine zweite Kollegin oder einen Kollegen anzustellen. Zu zweit liessen sich Berge bewegen.