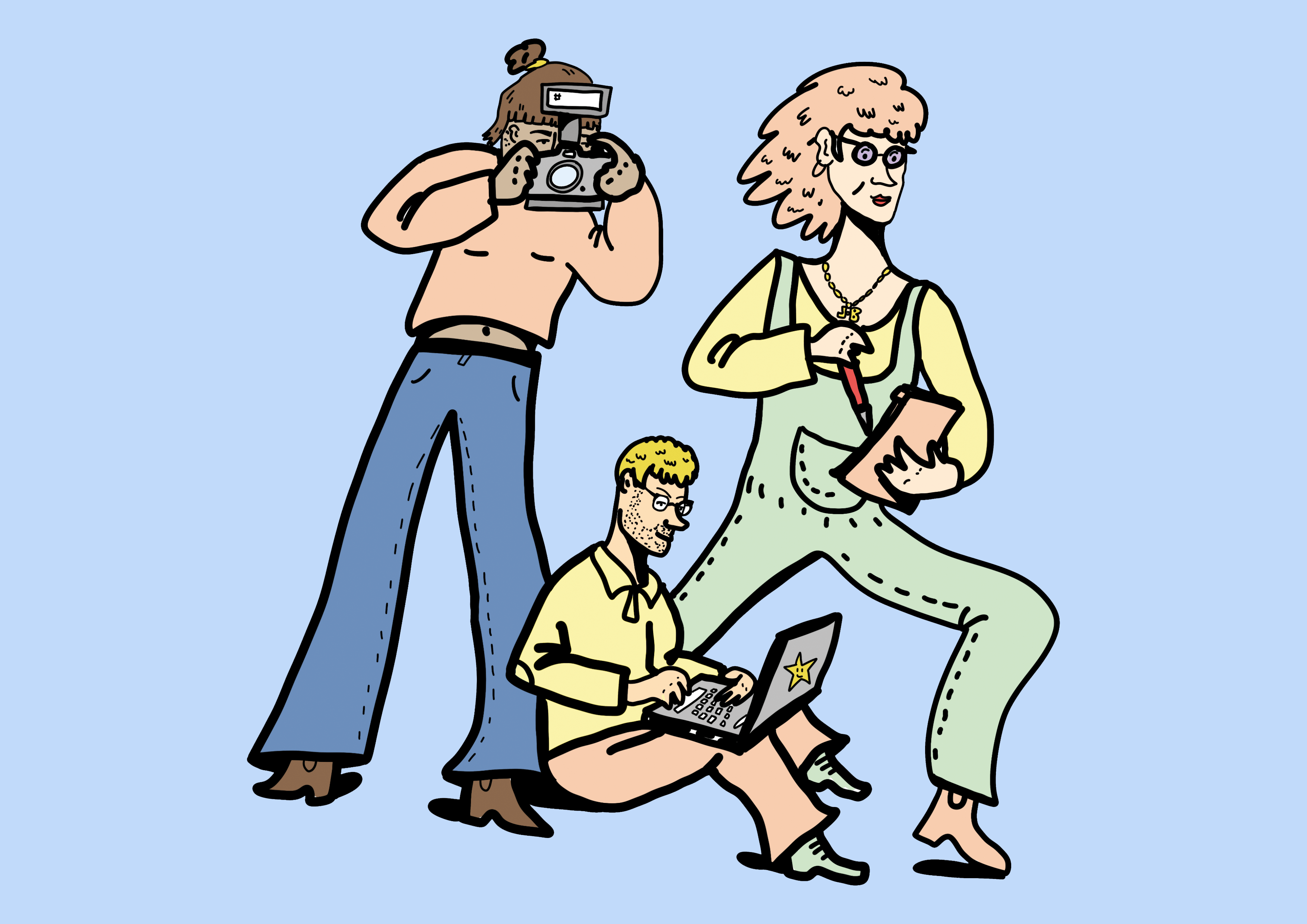Die Soziologie entdeckt den Raum neu. Ein Grund sind regionale und soziale Ungleichheiten, die gängige Ordnungen stören. Vernachlässigte Quartiere und benachteiligte Gruppen kontrastieren glanzvoll aufpolierte Orte. Sie dokumentieren desintegrative Prozesse und zeigen, wie unterschiedlich sich Menschen soziale Räume aneignen und eigene Ordnungen kreieren.
Soziale Räume sind Räume der Beziehungen. Sie lokalisieren sich an Orten, die sich wie Räume betrachten lassen. Räume bringen Orte hervor. Und umgekehrt. Orte haben Namen und – dank Wahrnehmung und Erinnerung – zeitliche Dimensionen. Sie sind mehr oder weniger ordentlich gestaltet.
Beliebte Orte
Beliebte Ordnungen entstehen an belebten Orten. In ihnen ist das Eigene erwünscht und aufgehoben. Susann Geiger berichtete mir von ihrem Gang zur «Läsi», den Räumen der allgemeinen Lesegesellschaft. Das ist für sie, beim Münsterplatz mitten in der Altstadt, der schönste Ort in Basel. Susann Geiger lebt allein und hat sich nach und nach ihr Alltagsleben ihrem Alter entsprechend eingerichtet – mit «Zeit nehmen» und «in Ruhe machen».
Mindestens einmal pro Woche geht sie in die Lesegesellschaft. Jedes Mal steht sie einen Augenblick still, wenn sie vor dem Münsterplatz die einmalige Schönheit tief in sich aufnimmt. Dann geht sie zur «Läsi», steigt über die alte Treppe in den Lesesaal hinauf, setzt sie sich ans Fenster und liest. Nach einer Weile schweift ihr Blick vom Buch auf den Rhein. Sie schaut der Münsterfähre zu, den Möwen, dem heranstampfenden Schlepper und wendet sich wieder der Lektüre zu. In dieser Atmosphäre fühlt sie sich wie verzaubert und freut sich, dass es einen so schönen Ort gibt, an dem für sie «alles in Ordnung» ist. Auch, weil sie sich die Zeit nimmt und den ruhig dahinfliessenden Rhein immer wieder neu entdeckt.
Beliebte Orte strukturieren das eigene und das gesellschaftliche Leben. Sie repräsentieren soziale Werte und dokumentieren ein geschichtliches und kulturelles Gedächtnis. Sie führen Menschen zusammen und laden dazu ein, zu sinnieren. Beliebte Orte prägen soziale Ordnungen, die soziales Verhalten ermöglichen und voraussetzen. Wir eignen uns Orte an. Was einen Ort ausmacht, hat viel mit uns und unseren Stimmungen zu tun.
Herkunft und Ressourcen
Erhebliche Unterschiede hängen allerdings von der sozialen Herkunft und von unseren Ressourcen ab. Diese entscheiden mit, welche Position wir im sozialen Raum einnehmen. Finanzielle, soziale und kulturelle Ausstattungen tragen wesentlich dazu bei, wie wir Orte und Ordnungen erleben.
Gustave-Nicolas Fischer beschrieb in «La Psychologie de l’espace» (1981), was beliebte und unbeliebte Orte unterscheidet. Unbeliebte Orte sind abgelehnte Orte ohne Erneuerung. Beliebte Orte sind akzeptierte Orte, die sich mit Symbolen des Wohlbefindens identifizieren lassen. Sie ermöglichen es uns, Autonomie zu erleben und aus alltäglichen Zwängen auszubrechen. Dabei besteht die Gefahr, bloss den Schein der Freiheit zu wahren und gewohnte Ordnungen zu reproduzieren. So können wir beispielsweise unsere Freizeit normieren, in dem wir sie an typischen Mechanismen der Arbeitswelt orientieren.
Flüchtige Orte
Wie räumliche Konfigurationen das menschliche Gefüge mitgestalten, thematisierte der Soziologe Georg Simmel vor über hundert Jahren in seiner Schrift «Der Raum und die räumliche Ordnung der Gesellschaft» (1908). Mit der stets abstrakteren Vergesellschaftung und der zunehmenden Bedeutung von Geld und Recht scheint der Raum an ordnender Funktion zu verlieren.
«Man spürt nicht mehr den tiefen Grund der Zeit und ihr langsames Fliessen», berichtete der afrikanische Schriftsteller Hamidou Kane über seinen ersten Besuch in Europa. Die Zeiten seien durch ihr mechanisches Ineinandergreifen fest gezurrt, die Strassen nackt. Man begegne Dingen aus Fleisch und Gegenständen aus Metall sowie Ereignissen, die sich aneinander reihen.
Der Soziologe Manuel Castells, der während Francos Diktatur aus Spanien fliehen musste, unterscheidet in seinem Buch über das elektronische «Informationszeitalter» (2004) zwischen privilegierten, peripheren und flüchtigen Orten, die zu Oberflächlichkeit verleiten. Sie gewinnen im Kontext der Globalisierung an Bedeutung und prägen das Verhalten in der Erlebnisgesellschaft.
«Der flexible Mensch» (Richard Sennett) muss mobil sein und Kontinuität verabschieden. Die fragmentierte Lebenswelt strapaziert die Dehnfestigkeit von Individuen und Familien. Das propagierte marktgerechte Menschenbild strebt eine Konsumkultur an, die Menschen nach der Kaufkraft beurteilt. Wir jagen immer schneller, immer weiter, immer mehr in ungebremster Wachstums- und Steigerungsdynamik den selbst entworfenen Möglichkeiten nach. So skizzierte der St. Galler Soziologe Peter Gross die «Multioptionsgesellschaft» (1994). Wirtschaft und Technik setzen Menschen in Bewegung. Sie rufen dauernde Unruhe hervor. Die verdichtete Zeit bedrückt und treibt uns. Sie bindet und entfesselt Energie. Wer nicht mithält, ist out. Wir fürchten ständig, etwas zu verpassen; obwohl wir nicht alles tun müssen, was wir tun können.
Bewegte Orte
Ich weiss nicht, woher meine Zuversicht rührt. Vielleicht von Jugendlichen, die auf Strassen tanzen oder ausrangierte Bahnareale beleben. Von Jugendlichen, die originelle Graffitis kreieren. Wie «Thu matsch!» Oder: «Wir scheitern nicht an Niederlagen, sondern an Auseinandersetzungen, die wir nicht wagen.» Jugendliche teilen uns so in wenigen Worten viel mit. Über sich und das gesellschaftliche Befinden. Sie drücken aus, was uns alle betrifft. Sie spiegeln uns und unsere Normen.
Und das nervt manchmal sehr. Mich stört zum Beispiel, wenn sich Jugendliche konsumistisch verhalten und besaufen. Auch, wenn sie das im Kollektiv tun. Das kritisierte ich auch in einer Vorlesung. Eine engagierte Studentin reagierte darauf. Sie meinte, das genussorientierte Verhalten der Jugendlichen kontrastiere das bierernste Arbeitsethos von uns Oldies und andern Workaholics. Das mag sein. Vielleicht ist das Hedonistische sogar minimal widerständig. Es kommt aber recht angepasst daher und neue soziale Ordnungen ähneln den alten.
Das Suchen nach Sinn
Politik interessiere sie überhaupt nicht, sagten mir Jugendliche, die Gewalt verübten. Sie bekundeten zudem, null Bock darauf zu haben, wie ein Rädchen in einem mechanischen Modell zu funktionieren. Und sie fragten, ob das Leben vor allem dazu da sei, alles schneller drehen zu lassen und die Effizienz zu steigern. Hinter diesen Fragen verbirgt sich das Suchen nach Sinn. Es fordert uns heraus. Schier subversiv und durchaus politisch.
Jugendliche können auch sehr pragmatisch sein. Das zeigt sich etwa bei Studierenden. Immer mehr wollen wissen, wie viele Kreditpunkte sie für die zusätzliche Lektüre eines Buches erhalten. Das irritiert mich. Aber diese rationale Haltung ist verständlich. Wir züchten sie herbei. Von der Primar- bis zur Hochschule. Und auch sonst. Mit einer Logik, die sich einseitig an dem orientiert, was unmittelbar nützlich ist. Dazu ein Beispiel: Wer in seiner Wohnung rechtzeitig den elektrischen Zähler abliest, nahm bislang in Basel-Stadt automatisch an einer Verlosung teil. Vielleicht geschieht dies bald auch bei der Steuererklärung, obwohl diese künstlichen Anreize die eigene Motivation eher unterlaufen.
Kommunikative Orte
Wir beklagen an Jugendlichen oft, was wir selber fördern. Auch ihren «Ego-Trip». Wer sich erfolgreich durchsetzt, gilt als Gewinner. Wirtschaftliche Unternehmen und PR-Agenturen favorisieren diesen Typ, der gegen andere punktet. Das Prinzip erleben wir von Kindesalter an. Wir profitieren von vermeintlichen Schwächen jener, die weniger clever sind. In der Schule und am Arbeitsplatz. Die drohende Erwerbslosigkeit forciert die Konkurrenz. Und sie rivalisiert die Kollegialität. Wenn meinem Arbeitskollegen ein Fehler unterläuft, wertet er meine Stellung auf. Dieser gängige Mechanismus schürt Ressentiments und schwächt solidarische Bande.
Jugendliche, die auf Strassen und Hinterhöfen tanzen, halten ihre kommunikative Geselligkeit hoch. Und sie wehren sich, wenn sie deswegen bekrittelt werden. Sie fragen: Was verliere ich, wenn ich nicht gewinne? Und sie wollen weder vereinnahmt werden, noch für jeden Event ein Formular ausfüllen.
Diese Widerborstigkeit ist keineswegs neu und bringt eigene Ordnungen hervor. In den 1950er-Jahren kamen Rock’n Roll, Jeans und Lederjacke auf. James Dean lehnte sich in «Rebel Without a Cause» gegen Gesetze und autoritäres Gehabe auf. In den 1960er-Jahren radikalisierte der Vietnamkrieg den Protest. Ökologische Debatten prägten die 1970er-Jahre. Mit Irokesen-Haarkamm drückten Jugendliche in den 1980er-Jahren ihre «No future»-Haltung aus. Dann folgten die Börsen-Yuppies. Sie präsentierten gegen Ende des 20. Jahrhunderts einen neuen «Look» mit Markenartikel.
Und wo stehen Jugendliche heute? Nun, sie bilden keine einheitliche Sozialkategorie. Wie 1968. Auch damals gab es nicht nur Beatles.
Authentische Orte
In der privilegierten Schweiz klagen heute etliche Jugendliche über Stress. Sie trinken viel Alkohol und weisen im internationalen Vergleich eine extrem hohe Selbstmordrate auf. Rund ein Viertel der männlichen und gut ein Drittel der weiblichen Jugendlichen fühlen sich deprimiert und nervös.
Jugendliche sind auch überdurchschnittlich von Arbeitslosigkeit betroffen. Und immer mehr finden nach ihrer Ausbildung keinen Einstieg ins Erwerbsleben. So verbreitet sich ein Bewusstsein, trotz Anstrengung auf keinen grünen Zweig zu kommen.
Das ist fatal. Wir müssen uns gesellschaftlich noch mehr auf die berufliche Ausbildung und Integration konzentrieren. Jugendliche wollen aber nicht nur malochen und konsumieren, sondern öffentliche Räume und Ordnungen mitgestalten. Das ist erfreulich und bringt Konflikte mit sich, die verbinden können. Auch, weil Reibung Wärme erzeugt. Wichtig sind Prozesse des gemeinsamen Aushandelns. Und da sind Jugendliche, die tanzen und Hinterhöfe beleben, auf Persönlichkeiten angewiesen, die Störungen als gesellschaftliche Herausforderung annehmen und nicht einfach polizeilich angehen. Identität und Authentizität kommen zum Tragen, wenn Widersprüche zugelassen sind.
Verbindliche Orte
Zwangsgeborgenheit und enge Kontrollen prägen ländliche Dorfgemeinden und die «Kuhstallwärme der Gemeinschaft» (Theodor Geiger). Das war und ist für etliche Menschen ein Grund, in die Anonymität städtischer Agglomerationen aufzubrechen. Sie suchen ihre Freiheit in sachlich-distanzierten Beziehungen. Doch diese erweisen sich auch als recht brüchig und kühl. Das fördert allerdings da und dort die Bereitschaft, wieder soziale Verbindlichkeiten einzugehen, und zwar frei gewählt. Das kann eine Chance sein.
Neue Komplexitäten erfordern zudem Differenzierungen, die pluralisierte Strukturen berücksichtigen. Alte Konzepte der Identität gehen von relativ homogenen Sozialstrukturen aus. Sie sehen eine deckungsgleiche Übereinstimmung von Anspruch und Wirklichkeit vor. Heute ist es jedoch unabdingbar, Identitäten zu entwickeln, die Ambivalenzen zulassen und in der Lage sind, offen mit Widersprüchen umzugehen, ohne alles offen zu lassen oder beliebig zu relativieren. Neue Identitäten orientieren sich an vielfältigen Realitäten. Sie entsagen jener bedrückenden Enge, die recht gemütlich wirkt.
Der rasche soziale Wandel beinhaltet aber auch die Gefahr, Menschen so zu verunsichern, dass sie sich wieder stärker rückwärts orientieren und Halt in ausgrenzenden Gemeinschaften und alten Ordnungen suchen. Wer materielle Einbussen und soziale Abstiege erfährt, ist besonders gefährdet. Einzelne von ihnen sind aber auch besonders motiviert, sich mehr für ihre eigenen Interessen und soziale Ordnungen einzusetzen.