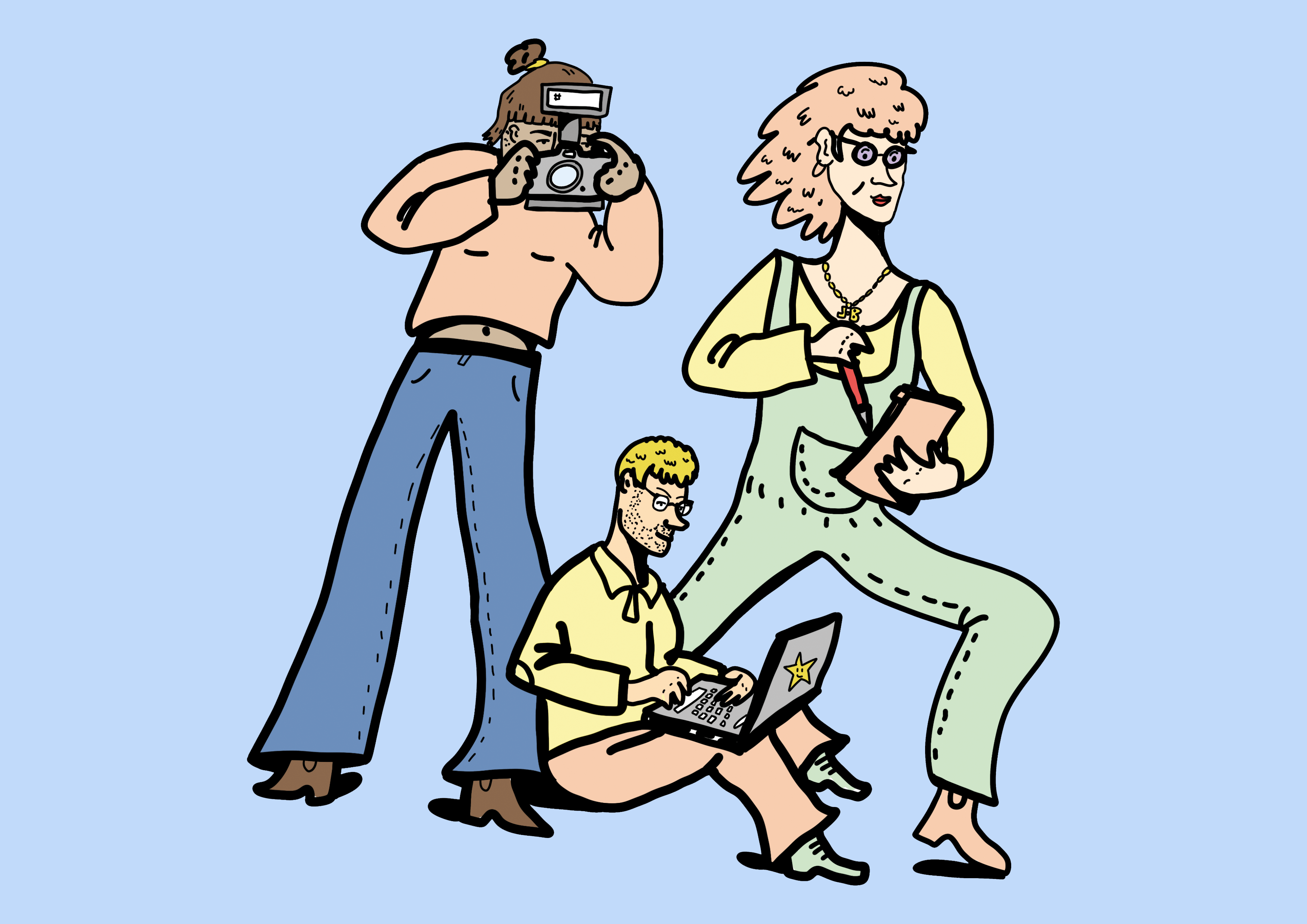Es gibt kaum ein Wort, das leichter über die Lippen geht als «Mainstream». Mainstream ist bedeutungsoffen. Es meint immer die Anderen. Und wird definiert von denen, die es verwenden.
Mit Widerspruch ist kaum zu rechnen. Immerhin leben wir in einer Welt, die riesige Geldmengen dafür einsetzt, möglichst viel Mainstream zu produzieren. Um dann wieder riesige Geldmengen zur Verfügung zu haben, den produzierten Mainstream weiter zu verbreiten. Mainstream ist ein Perpetuum Mobile. Es ist ein Synonym für Erfolg – oder für das, was auf den Erfolg folgt. Den Erfolg des Erfolgs sozusagen. In so einem Sinn wird der Begriff allerdings kaum verwendet. Am Erfolg, scheint es, wollen alle partizipieren. Vom Mainstream grenzen sich alle ab. Selbst die Erfolgreichen.
Im Medienarchiv finde ich den Begriff zum ersten Mal in Verbindung mit Jazz. In einem Beitrag der NZZ von 1959 ist von «Mainstream-Jazz» die Rede. In nächsten Beiträgen heisst es dann nur noch «Mainstream», der eine bestimmte Form des Jazz zu bezeichnen scheint. In Abgrenzung etwa zum «Dixieland» oder zum «Swing».
Ein NZZ-Auslandsbeitrag aus Kalkutta von 1970 berichtet von regierungsnahen Zeitschriften in Indien, die Titel tragen wie «Patriot», «Link», «Mainstream», «Blitz» oder «New Age».
Der Doppelbegriff «Medien-Mainstream» (der die Formulierung «linker Medien-Mainstream» ablöst und impliziert) taucht ab 2001 in der Schweiz auf. Bemerkenswerterweise vor allem dann, wenn vom Jean-Frey-Konzern und der inhaltlichen Neuausrichtung der «Weltwoche» die Rede ist. So versuchte beispielsweise die «Südostschweiz» in einem Interview mit Moritz Leuenberger diesem den Begriff in den Mund zu legen. Leuenberger schien aber wenig damit anfangen zu können. Zuvor hatte er sich sehr dezidiert gegen das «Versteckspiel» der neuen «Weltwoche»-Besitzer ausgesprochen. Und der damalige WoZ-Journalist Constantin Seibt umschrieb 2002 gegenüber der NZZ das neue publizistische Konzept der «Weltwoche»: «Der Story-Generator ist das Anti-Korrektheits-Prinzip. Sieh, was der behauptete Medien-Mainstream sagt, und schreibe das Gegenteil.»
Die Behauptung des «Medien-Mainstreams», offenbar in der Schweiz eingeführt, um von Christoph Blochers Medien-Engagements abzulenken und diese zu legitimieren, wird also seit gut zehn Jahren gepflegt. Jüngstes Beispiel ist Ueli Maurers Rede am Schweizer Medienkongress vom 13. September 2013. Im nachfolgenden Interview mit der Zeitung «Schweiz am Sonntag» vom 29. September wurde Maurer dann sogar noch eine Spur expliziter: «Es gibt ihn nun mal, den Mainstream. (…) Zudem haben die meisten Medien ihre Tabu-Themen, die sie totschweigen, vielleicht mit Ausnahme der ‚Weltwoche’, der ‚Basler Zeitung’ (…). Während Jahren wurde etwa die Ausländerkriminalität tabuisiert».
Diese letzte Behauptung wäre auch in ihrer Geschichte zu untersuchen. Mittlerweile wird sie selbst von Linken wiedergekäut.
«Ein Politiker wie Blocher schreibt seine politischen Taten in die Sprache selbst ein: Er nimmt Wörter, entstellt ihren Sinn, erfindet neue Wörter, schafft eine neue Realität, eine neue Sprache, die wiederum von den anderen politischen Parteien übernommen wird», sagte der Regisseur Jean-Stéphane Bron im Interview mit der Zeitung «Schweiz am Sonntag» vom 13. Oktober 2013. Wie bewusst sich Blocher dieses Vorgangs ist, verriet er unter anderem in seiner «Bilanz nach einem Jahr im Bundesrat» von 2004. Er sprach damals von der «Positiven Entkrampfung» der Politik, die er am folgenden sprachlichen Beispiel erläuterte: «Es wird direkter über Probleme gesprochen. Begriffe wie ‚Scheininvalide’ werden über die Parteigrenzen hinweg und in der Öffentlichkeit verwendet, um ein Problem zu beschreiben, das tatsächlich existiert».
Das Wort «Scheininvalide» taucht laut Medienarchiv in der Schweiz ab 2003 regelmässig auf, zuerst und gehäuft in der «Weltwoche».