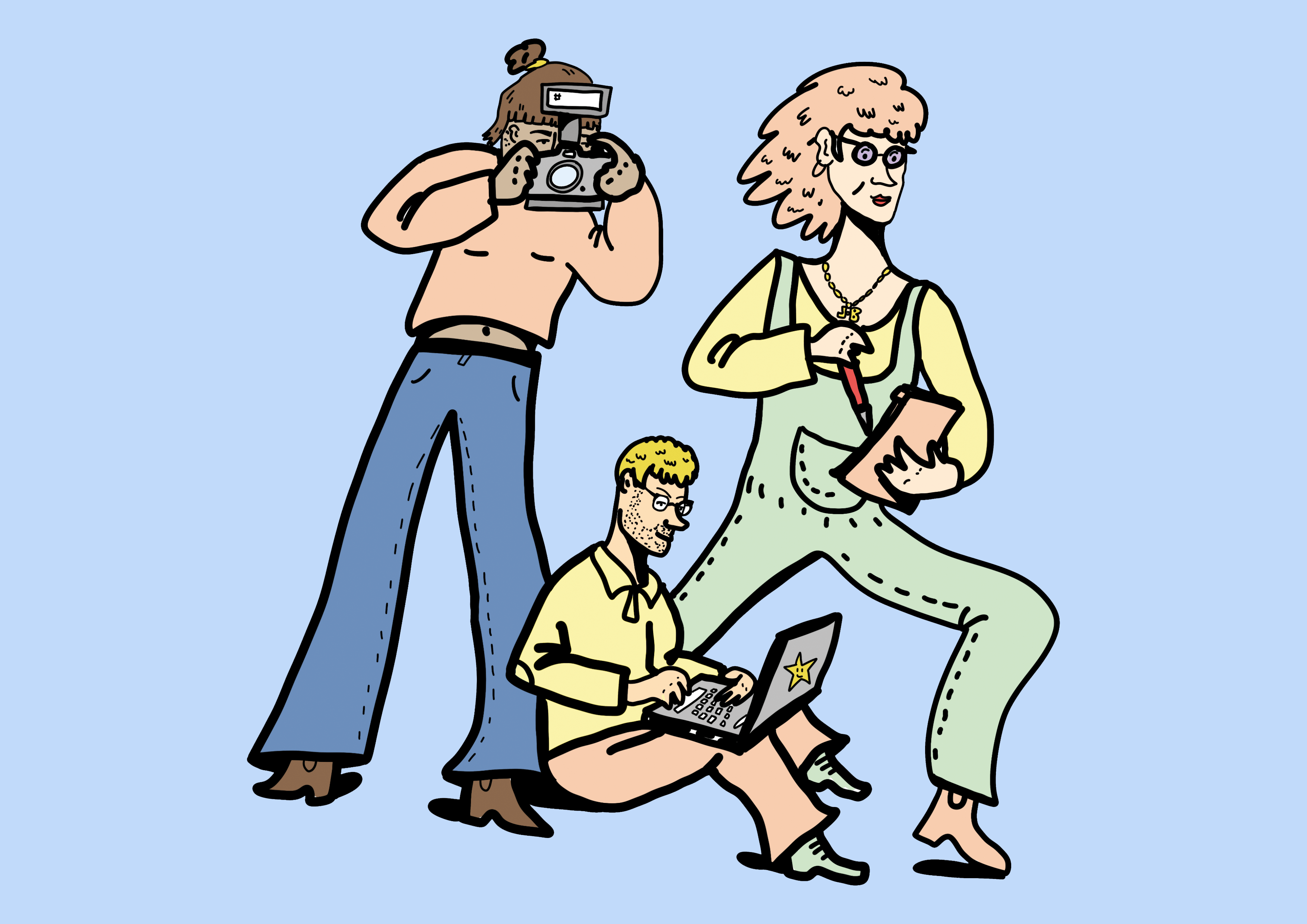Sozialhilfe funktioniert in der Schweiz so: Es gibt keine nationale Rahmengesetzgebung, die Kantone sind in allen Bereichen alleine zuständig. Das gilt sowohl für die Ausrichtung der Sozialhilfe, als auch für die Finanzierung. Einzig die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe erlässt jährlich eine Richtlinie, in der Empfehlungen für das kommende Jahr abgegeben werden. Verbindlich ist diese Richtlinie zwar nicht, trotzdem nehmen viele Kantone in ihren Gesetzen darauf Bezug.
Konfliktpotential durch Aufgabenteilung
Das bernische Sozialhilfegesetz sieht eine Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden vor. Demnach legt der Kanton die Ziele der Sozialhilfe fest und sorgt für die Bereitstellung, Finanzierung, Koordination und Überprüfung der Leistungsangebote. Die Gemeinden hingegen vollziehen die individuelle Sozialhilfe, sie bilden mit ihren BeamtInnen die Schnittstelle zwischen Behörde und SozialhilfeempfängerInnen. Diese Aufgabenteilung birgt mithin Konfliktpotential, müssen doch die Gemeinden die vom Grossen Rat beschlossenen Sparmassnahmen regelmässig ausbaden. Über diese Differenzen redet man aber nicht gerne, schliesslich soll der Financier nicht vergrault werden.
Grosser Rat senkt den Grundbedarf
Doch der Kanton spart jetzt ohnehin: um bis zu acht Prozent unter der SKOS-Richtlinie wird der Regierungsrat den neuen Grundbedarf für SozialhilfeempfängerInnen festlegen, das hat der Grosse Rat Anfang Dezember im Rahmen der Überarbeitung des Sozialhilfegesetzes (SHG) beschlossen. Nota bene nachdem die SKOS den Grundbedarf schon 2015 herabgesetzt hatte und dafür in Kritik geraten war. Auf Antrag wurde die vom Regierungsrat verlangte höhere Kürzung immerhin noch um zwei Prozentpunkte gesenkt. Der Regierungsrat lässt in der Botschaft zum Gesetz verlauten, dass er der Auffassung sei, dass trotz der nun beschlossenen Senkung des Grundbedarfs nach wie vor nicht nur die blosse Existenz der Empfängerinnen und Empfänger, sondern auch eine gewisse Teilhabe am sozialen Leben gesichert sei.
Klar ist, dass der Kanton und die Stadt nicht dieselben Interessen verfolgen. Die Stadt hat wenig Interesse an der Senkung des Grundbedarfs. Gerade für die ArbeiterInnen des Sozialamts bedeuten Senkungen mehr Konflikte und mehr Diskussionen. «Ich denke, dass die Auseinandersetzungen mit den Klienten und die Aggressionen zunehmen werden, weil die Situation der Personen immer schwieriger wird», sagt Felix Wolffers, Leiter des Stadtberner Sozialamtes gegenüber Journal B. Der Kanton dagegen hat eine finanzpolitische Optik, er ist weit weg vom Tagesgeschäft. Für ihn ist die Sozialhilfe ein Kostenfaktor: 2015 beliefen sich die Ausgaben auf 450 Millionen Franken. Einen Betrag, den es gemäss der Direktion Schnegg offenbar zu reduzieren gilt.
Weniger als 500 Franken Grundbedarf pro Kopf
Die Auswirkungen dieser Reduktion werden die SozialhilfeempfängerInnen direkt zu spüren bekommen. Wolffers beschönigt nicht: «Wir gehen davon aus, dass die Kürzung eigentlich nicht mehr tragbar ist.» Schon jetzt liege der SKOS-Ansatz unter dem Zielwert, welcher dem Einkommen der untersten 10% der Bevölkerung entspräche. «Bei einer vierköpfigen Familie läge der Ansatz für den Grundbedarf nach der Revision pro Person dann unter 500 Franken.» Ausserdem gebe es gerade bei Familien mit Kindern wenig Möglichkeiten die Einsparungen zu kompensieren, was zulasten der Kinder gehen könnte. Man müsse sich fragen, ob mit der erneuten Senkung überhaupt noch ein vernünftiges Haushalten möglich sei.
Unfaire Kompensation
Gleichzeitig mit der Senkung wurden die Integrationszulagen erhöht, d.h. SozialhilfeempfängerInnen, die sich besonders um eine Stelle bemühen können auch nach der Revision den jetzt geltenden Grundbedarf erreichen. Die Suggestion dieser vermeintlichen Kompensation der Senkung des Grundbedarfs durch Anhebung der Integrationszulage ist klar: Wer fleissig ist bekommt den vollen Betrag, wer faul ist muss sich halt mit dem Minimum abfinden. Eine zutiefst unfaire Folgerung, setzt sie doch voraus, dass die Betroffenen überhaupt arbeiten können und nicht aufgrund von Kinderbetreuung, Krankheit, Invalidität oder anderer Gründe verhindert sind. Auch Wolffers ist nicht überzeugt: «Unsere Erhebungen zeigen, dass ein Grossteil der Leute von diesem System nicht profitieren wird».
Ebendieses neue Integrationsprogramm wird eine Arbeitsgruppe ausarbeiten. Irritierend ist jedoch, dass die Stadt Bern – trotz explizitem Beteiligungswunsch – darin nicht vertreten sein wird. Wie lässt sich das angesichts der Tatsache, dass die Stadt Bern unter allen Gemeinden des Kantons über das grösste Knowhow verfügt, erklären? Bei der Stadt Bern kann oder will man sich das nicht erklären. Im Bund äussert sich der Generalsekretär der Gesundheits-und Fürsorgedirektion Yves Bichsel knapp zum Entscheid: Die Teilnahme der Stadt Bern stehe nicht im Vordergrund, stattdessen müsse die Wirtschaft besser miteinbezogen werden.
Vorerst ist jetzt die zweite Lesung im Grossen Rat abzuwarten, danach bliebe allenfalls das Referendum. Ob ein solches im Kanton Bern Chancen hätte ist jedoch zu bezweifeln.