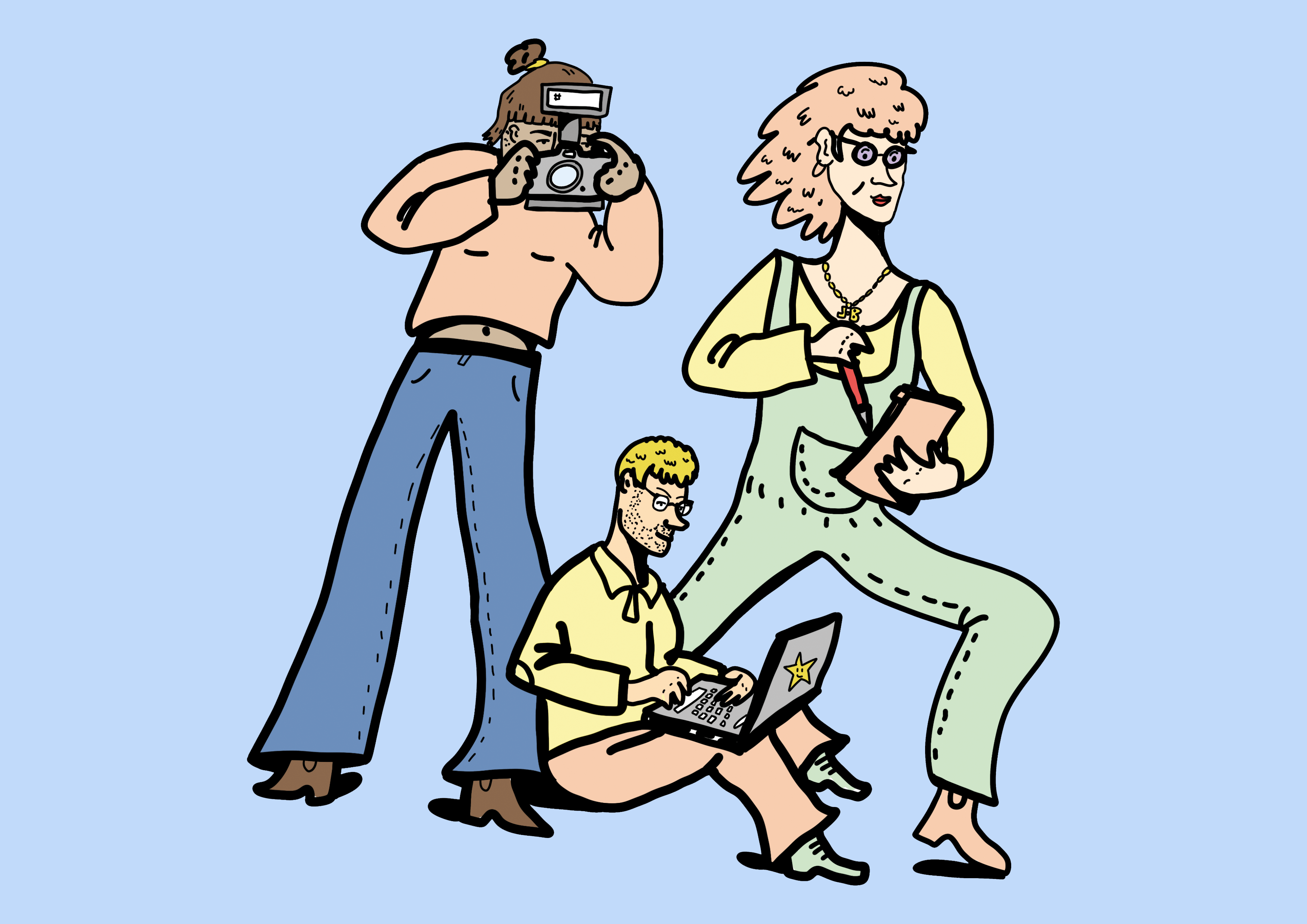Ein Nachteil der direkten Demokratie ist zweifellos, dass sie die Verantwortung für unmenschliche politische Entscheide den einzelnen Stimmberechtigten zuweist. Am 9. Juni 2013 zum Beispiel haben 1’573’007 SchweizerInnen ein linkes Referendum abgelehnt und damit neue Verschärfungen im Asylgesetz gutgeheissen. Unter anderem wollten diese gut anderthalb Millionen Leute, dass ab sofort in Schweizer Botschaften im Ausland keine Asylanträge mehr gestellt werden können. Seither muss, wer einen solchen Antrag stellen will, zuvor zwingend Schweizer Boden erreicht haben. Salvatore Pittà, migrationspolitischer Aktivist seit mehr als zwanzig Jahren, sagt: «Alle, die für die Abschaffung des Botschaftsasyls gestimmt haben, tragen heute eine Mitverantwortung an der eventualvorsätzlichen Tötung von Menschen, die im Mittelmeer ertrinken, weil sie einen Asylantrag an die Schweiz hätten stellen wollen.»
Pittà ist ein liebenswürdiger und kluger Gesprächspartner. In diesem Punkt formuliert er scharf, um klarzustellen: In diesen Tagen, in denen so viele im Mittelmeer ertrinken, kann das «Alarmphone» – für das in der Schweiz massgeblich er steht – leicht als Ausrede dienen im Sinn von: Immerhin helfen die Linken und Netten im Land ja mit, dass nicht allzu viele sterben. Pittà: «Uns geht es nicht darum, rein humanitär zu helfen, damit die unmenschliche Asylpolitik nicht allzu unmenschlich wirkt. Uns geht es um das Menschenrecht, einen Asylantrag stellen zu können, ohne dafür ertrinken zu müssen. Unser Ziel ist eine Welt ohne Grenzen, und solange es Grenzen gibt: dass der Grenzübertritt einer Person nicht zum Verlust von Rechten führt.»
Darum hat er das Alarmphone mitaufgebaut, das von Schichtteams in ganz Europa und von je einem in Marokko und Tunesien betreut wird. Eines arbeitet von Bern aus. Worum geht es?
Die internationale Zivilgesellschaft reagiert
Salvatore Pittà sitzt mitten in der Stadt Bern im Büro von «Solidarité sans frontières» und beginnt zu erzählen: «Seit 2011 bin ich Schweizer Verantwortlicher des Netzwerks ‘Welcome to Europe’, einem Netzwerk, das online unabhängige Informationen für Migranten und Migrantinnen anbietet und auch Telefonberatungen macht, insbesondere zu Fragen, die das Dublin-Abkommen betreffen, also Fragen rund um Asylanträge.»
Am 3. Oktober 2013 kommt es vor Lampedusa zu einer Katastrophe. Über zweihundert Personen ertrinken, weil die italienischen und die maltesischen Behörden auf Hilferufe per Satellitentelefon zu spät reagieren. Seither diskutieren internationale asylpolitische Netzwerke – unter anderen «Welcome to Europe» – die Frage: Wären die Menschen zu retten gewesen, wenn es eine unabhängige zweite Hotline gegeben hätte? Schliesslich lancieren sie ein Alarmtelefon, federführend wird «Watchthemed», Mitte Oktober 2014 wird man operativ tätig. Pittà: «Einzelinitiativen wie jene von Nawal Soufi und Mussie Zerai, mit denen wir zusammenarbeiten, gab es schon vorher. Neu am Watchthemed-Projekt ist, dass nun der ganze Mittelmeerraum multilingual mit einer einzigen unabhängigen Alarmrufnummer vierundzwanzig Stunden pro Tag und sieben Tage pro Woche abgedeckt wird.»
Im September 2014 übernimmt es Pittà, die Idee des «‘Watch the Med-Notruftelefons’ für Boatpeople» in der Schweiz zu lancieren. Zuerst entsteht eine Regionalgruppe in Bern, später weitere in Basel und Zürich. Vier Aktivistinnen – drei aus Bern, eine aus Zürich –, sind bereit, ein Schichtteam zur Betreuung des Alarmphones aufzubauen. In Einzelgesprächen und Schulungen werden sie auf ihre Aufgabe vorbereitet. Seit der zweiten Hälfte Januar garantieren sie pro Monat drei achtstündige Schichten.
Im Raum mit der Telefon- und Internetinfrastruktur sitzen die Teammitglieder während ihrer Schicht über Medienarbeiten, Recherchen, Evaluationen oder Nachbearbeitungen von Fällen. Klingelt das Alarmtelefon, geht es plötzlich um jede Sekunde: Sprache finden; Kontakt halten und Satellitentelefon finanziell absichern. Situation? Wie viele Leute? Verletzte? Lage? (GPS-Ortung des Satellitentelefons und damit des Boots). Und dann: Wer muss alarmiert werden? Wer hilft? Der Einsatz dauert, bis die Meldung kommt, dass die Leute sicher gelandet sich – bestenfalls auf europäischem Boden.
«Für uns ist die Zusammenarbeit mit den Küstenwachen zentral», sagt Pittà. «Gleichzeitig ist es so, dass ihr politischer Auftrag in genauem Gegensatz zu unseren Zielen steht. Wir haben sie deshalb über uns so informiert: Wir helfen euch mit unseren Mitteln, die Schiffbrüchigen zu retten, aber wir üben auch eine zivilgesellschaftliche Kontrolle aus: Falls ihr nichts tut, zu langsam reagiert oder die Leute illegal zurückschafft, schlagen wir Alarm und machen öffentlichen Druck.»
Was kann man in Bern tun?
Zurzeit braucht es noch weitere Alarmphone-Schichtteams. Diese Arbeit ist anspruchsvoll. Wer mitmachen will, muss sich für monatlich drei Schichten à acht Stunden verpflichten, und zwar – weil die Einarbeitung zwei Monate dauert – nicht bloss für kurze Zeit. Beherrschen muss man die englische Sprache, günstig ist dazu die französische, ideal ist natürlich, wenn eine Mittelmeersprache oder eine Migrationssprache dazu kommt (Arabisch, Farsi, subsaharianische Sprachen). Dazu braucht es ein Flair für den Umgang mit Informationstechnik. Dazu psychische Robustheit in Stresssituationen. Und: Das ist ehrenamtliche Arbeit.
Daneben gibt es Arbeiten zu tun, die einfacher zu packen sind: Fundraising, Medienarbeit (inkl. Aufbau einer Homepage), Regionalgruppenarbeit, Organisation von Flashmobs etc. Oder man spendet, denn Geld braucht es immer: für die sofortige Alimentierung der Satellitentelefonkonti von Anrufenden; für die Reisespesen, die bei den nötigen internationalen Schichtteam-Treffen anfallen; für Material- und Infrastrukturkosten etc.
«Wenn du mich fragst, wieviele Menschen das Alarmphone bisher gerettet hat», sagt Pittà in seinem Büro, «dann sage ich: niemanden. Am Schluss sind es die Küstenwachen oder die kommerziellen Schiffe vor Ort. In zwei Fällen machten wir in Italien mit E-Mail-Kampagnen Druck und erreichten, dass die Küstenwachen aktiv wurden. Rund 700 Leute konnten dabei gerettet. Hier halfen wir direkt. Für weitere rund 10000 Menschen konnten wir in fünfzig bis hundert Einzelfällen durch Kommunikation und Mediation die Rettungsaktionen unterstützen.»