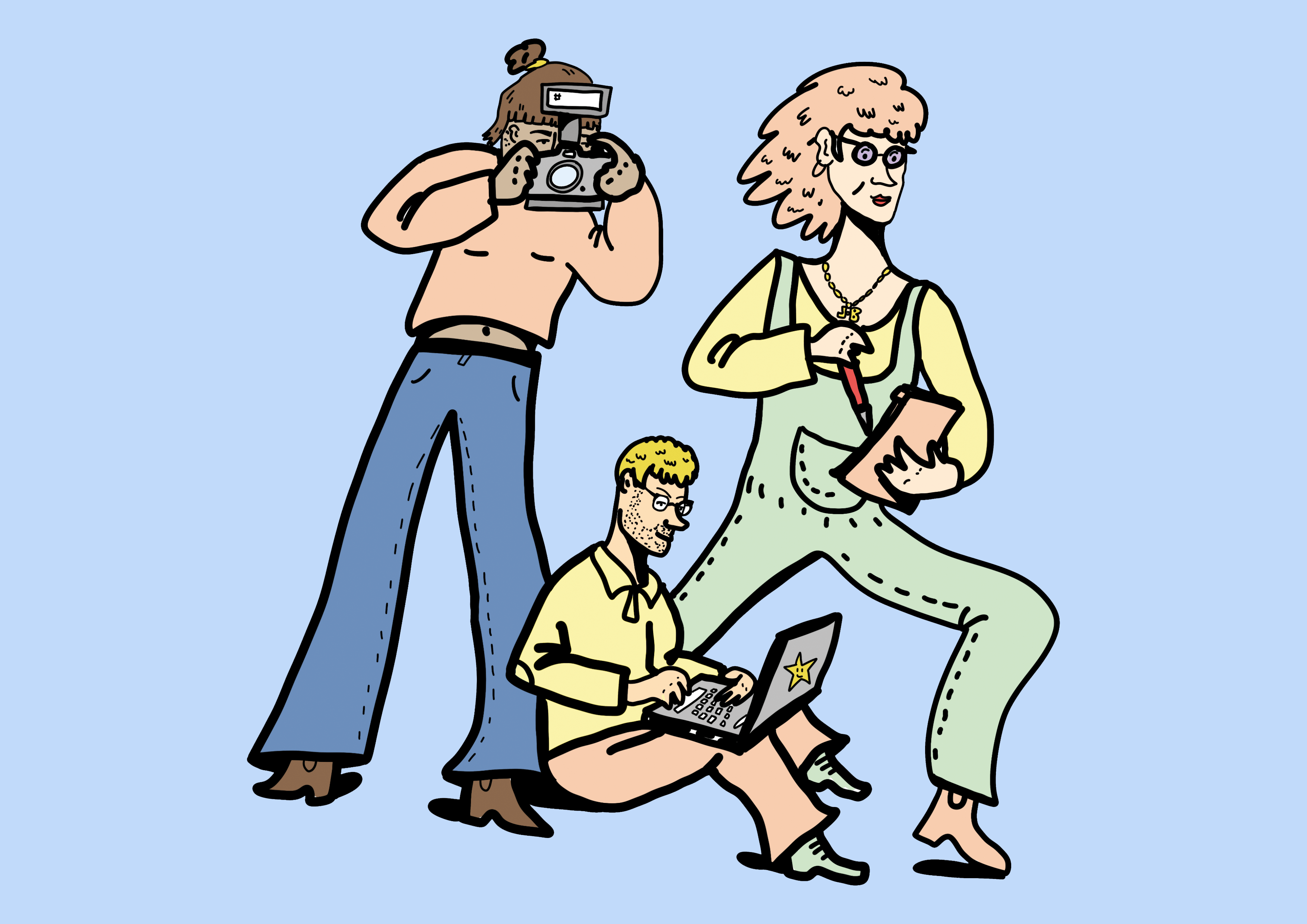Der Ruf des mehrheitlich rot-grünen Berner Gemeinderats in der Region war nicht der beste. Man zeige zu wenig Verständnis gegenüber den Aussengemeinden, wurde kritisiert, und trete hochnäsig und belehrend auf. Aber es war kein RGM-Vertreter, der vor bald 15 Jahren mit ein paar geschickt in eine Augustansprache eingeflochtenen Provokationen den Funken zündete, der bis heute nachschwellt, es war ein Freisinniger. Einer allerdings der alten, liberalen, heute eher raren Schule: Christoph Stalder, damals Stadtratspräsident. «Ich träume nicht von einem Gross-Bern wegen seiner Grösse», sagte er am 1. August 2001 auf dem Münsterplatz, «aber ich meine, dass die wirtschaftliche, die kulturelle, die bildungspolitische, die verkehrsmässige Wirklichkeit mit den heutigen politischen Grenzen nicht mehr übereinstimmt.» Deshalb müsse die Vereinigung von Stadt und «umliegenden Vorortsgemeinden» ohne Vorurteile geprüft werden.
Reden über den Gartenzaun
Die Vereinigung wurde nicht geprüft, von keiner Seite. Und die Vorurteile wurden nicht abgebaut, im Gegenteil: Unter Gemeindepolitikern der Region stand der von Christoph Stalder an sich wertfrei eingebrachte Begriff «Gross-Bern» auf einmal pauschal für die Expansionsgelüste der Stadt. Das Thema Fusionen war rasch wieder vom Tisch, und es spielte jenes Muster, das die regionale Entwicklung bis heute bestimmt und bremst: man begnügt sich mit gemeindeübergreifender Zusammenarbeit, wo es nötig ist oder vom Kanton vorgeschrieben wird, pocht aber sonst auf Autonomie, Identität und Tradition.
Regionale Zusammenarbeit gab es bereits vor 15 Jahren. Tram und Bus fuhren schon damals bis in die Vororte, und im Verein Region Bern (VRB) waren 47 Gemeinden organisiert. Was sie besprachen und beschlossen, war nicht bindend. Aber man lernte miteinander zu reden. Im VRB sei das «Gärtlidenken» überwunden worden, sagen Gemeindepolitiker, die damals aktiv waren.
Als Reaktion auf die ersten Erfahrungen mit der viel grösseren Regionalkonferenz Bern-Mittelland werden die guten alten Zeiten des Vereins Region Bern neuerdings wieder nostalgisch herauf beschworen. In der vom Verein Bern NEU gründen mit seiner Studie zur Zukunft der Stadtregion lancierten Debatte ist das Bedürfnis nach einfacheren regionalen Organisationsstrukturen offensichtlich, gerade und vor allem von Seiten ehemaliger wie amtierender Gemeindevertreterinnen und -vertreter.
Man sollte den VRB nicht verklären. Vielleicht funktionierte er gerade darum so gut, weil es keine Verbindlichkeit gab. 2002 beklagte sich der Verein selber darüber, dass «keine politischen Strukturen» bestünden, «mit denen die Probleme der Agglomeration in einem einigermassen vernünftigen Zeitraum nachhaltig und verbindlich gelöst werden können». Zwei Jahre später schob der Regierungsrat den politischen Prozess an, der zur Bildung der heutigen Regionalkonferenzen führte.
Gewachsener regionaler Raum
Die Regionalkonferenz Bern-Mittelland ist – vereinfacht dargestellt – der grössere Verein Region Bern. Ihre Entscheide, das ist anders, sind für die 85 Mitglieder verbindlich, aber eigentlich führt sie die Arbeit des früheren Vereins mit anderen Mitteln fort: die Regionalkonferenz koordiniert «gemeindeübergreifende Aufgaben» und realisiert «gemeinsame Lösungen und Projekte». Besser kann man es nicht sagen, dass man sich auch in dieser neuen regionalen Zusammensetzung nicht gegenseitig auf den Füssen herumstehen will. Genau genommen ist die Region Bern politisch noch immer der gleiche Schrebergarten wie eh und je.
Auch wenn nun allenthalben das Lamento über das zu weit verzweigte und schwerfällige Konstrukt Regionalkonferenz angestimmt wird: dass sie kleine, ländliche Gemeinden in der weiteren Region mit der Zentrumsstadt und den verstädterten Gemeinden um sie herum zusammen führt, ist ihre Qualität. Für den Verkehr, den Wohnungs- und Siedlungsbau und überhaupt die Raumplanung, für die Kultur, für die wirtschaftliche Entwicklung und grössere Infrastrukturprojekte lassen sich nur in einem breiten Verbund wirklich nachhaltige Lösungen finden. Auch die immer wieder bemühten, angeblichen Stadt/Land-Animositäten liessen sich hier bereinigen – vorausgesetzt, man will das wirklich. Neue Formen des politischen und gesellschaftlichen Zusammenlebens hingegen – da liegen die VRB-Nostalgiker nicht ganz falsch – müssen in kleineren Zusammenschlüssen und Räumen gefunden werden.
Kleiner als die Regionalkonferenz, aber nicht so kleinräumig wie die bisherigen Gemeinden: Das ist die Stadtregion Bern mit 240’000 Einwohnerinnen und Einwohnern und 190’000 Arbeitsplätzen, der die Gemeinden Bern, Köniz, Ostermundigen, Muri, Ittigen, Zollikofen, Wohlen, Bolligen, Bremgarten, Kehrsatz, Kirchlindach und Frauenkappelen angehören. Die zweitgrösste Stadt der Schweiz, aber im internationalen Vergleich noch lange keine Metropole. Urban und ländlich; politisch, wirtschaftlich und sozial überschaubar. Warum sollte, was Köniz vormacht, nicht in der ganzen Region funktionieren?
Die im September 2014 publizierte Studie «Bausteine für die Stadtregion Bern 2030» entwirft das Profil eines gänzlich anderen politischen Modells regionalen Zusammenlebens: Die Stadtregion Bern ist keine kleine Regionalkonferenz und kein halber Verein Region Bern, sie ist ein gewachsener Raum. Die Studie denkt zu Ende, was im Alltag der überwiegenden Mehrheit der regionalen Bevölkerung längst selbstverständlich ist. Sie zeigt auf, wie folgenrichtig es wäre, wenn der gemeinsame Lebensraum auch politisch zur Einheit würde – dies insbesondere vor dem Hintergrund eines eher schwachen Wachstums und steigenden Kosten bei der Aufgabenerfüllung.
Veränderung und Verantwortung
Ein Zusammenschluss zur Stadtregion Bern brächte zuerst viel Umstellung und Veränderung. Die einen müssten vielleicht etwas mehr, die anderen etwas weniger Steuern bezahlen. Die politischen Gremien und Entscheidungswege würden neu organisiert, die Gemeinderäte und Gemeindeparlamente hätten nicht mehr das gleiche Gewicht, die klassische Gemeindeversammlung wäre ein Stadtteil-Forum. Böse Zungen – aber nur solche – behaupten, dies sei der hauptsächliche Grund dafür, dass sich in Sachen Gemeindefusionen so wenig bewege. Welcher Gemeindepräsident will schon als Verräter in die Dorfchronik eingehen?
Mit dem Zusammenschluss würden sich jedoch auch Möglichkeiten eröffnen, aktuelle politische Brennpunkte schnell und effizient zu entschärfen: In der Stadt, vermehrt aber auch in den Agglomerationsgemeinden, schrumpfen die Baulandreserven zum Teil dramatisch zusammen. Auf dem Gebiet der Stadtregion Bern könnten neue Bauzonen geschaffen werden, die der drohenden Wohnungsnot entgegen hielten und der Forderung der Raumplanung nach innerer Verdichtung nachkämen. Auch Verantwortlichkeiten würden neu verteilt: Das Nachtleben und die kommerzielle Überlastung des Zentrums wären nicht mehr nur «ein Problem der Stadt», sondern müssten in einem viel breiter gefassten Konzept zur Nutzung des öffentlichen Raums geregelt werden.
Die immergleichen Einwände
Der 2012 verstorbene Christoph Stalder war der erste Präsident des Vereins Bern NEU gründen. Jetzt hat der Verein mit der Studie zur Stadtregion Stalders alten Traum vom grossen Bern wieder aufgenommen. Die Stimmungslage ist weitgehend noch die gleiche wie damals 2001: Es gibt nicht den Ansatz einer Annäherung zwischen Bern und den Agglomerationsgemeinden mit dem Ziel, sich zu vereinigen. Die Studie ist selber Ausdruck dieser Situation: Den Zeithorizont für die Stadtregion Bern setzt sie vorsichtig ins Jahr 2030.
Es sind die immergleichen Argumentationsweisen, welche seit rund 20 Jahren die politische Entwicklung der näheren Region Bern bei den entscheidenden Fragen auflaufen lassen. Sie bewegen sich alle, mehr oder weniger, auf emotionaler Ebene. Deshalb sind sie schwer zu kontern.
«Weshalb sollten wir uns mit der Stadt zusammen schliessen?», ist eine gängige Frage der Gemeindebehörden rund um Bern, wenn von Fusion die Rede ist. Es läuft ja gut, so wie es ist, warum also etwas daran ändern? – die Gartenlaubensicht hat sich bis heute erhalten, obwohl im einst hässlich «Speckgürtel» genannten Umland von Bern eben dieser Speck inzwischen auch vielerorts länger ausgekocht werden muss.
Rote Zahlen in Gemeinderechnungen sorgen für rote Köpfe unter Bürgerinnen und Bürger, aber ein wirklicher Leidensdruck, eine dringende Notwendigkeit, sich mit anderen Gemeinden zusammen zu tun, erschliesst sich daraus nicht. Es ist eher der Stillstand, der in den Regionsgemeinden gegenwärtig mehrheitsfähig zu sein scheint. Ortsplanungen werden abgelehnt, das Tram Region Bern bleibt auf der Strecke.
Die Kirche bleibt im Dorf
Das wirksamste Mittel gegen Fusionsideen ist der Angstmacher Identitätsverlust. Doch was genau ist die Identität der Agglomeration? Das Gefühl, daheim zu sein, hat wenig mit der Grenze der Gemeinde zu tun, in der jemand lebt, sondern mit dem eigentlichen Wohnort und dessen Umfeld. Mein Haus, meine Siedlung, die Migros am Ende der Strasse, der Geldautomat unten an der Ecke, das Café gleich daneben – das ist Daheim. Und so wird es auch nach einem Zusammenschluss mit anderen Gemeinden sein. Bolligen wird Bolligen bleiben, so wie Bümpliz auch bald 100 Jahre nach der Vereinigung mit Bern noch stark den sperrigen Geist des einstigen Dorfs atmet. Aber wenn Coca Cola schnöde ein Werk schliesst und 90 Arbeitsplätze zerstört, wird Bolligen nicht mehr allein damit fertig werden müssen, das wird dann Aufgabe der ganzen Stadt sein. Die Kirche bleibt im Dorf, die Linde auf dem Dorfplatz, und auch die Gemeindefahne wird bei festlichen Anlässen stolz über den Giebeln flattern. Das alles bleibt, auch wenn das Dorf ein Stadtteil ist, aber endlich eingebettet in einem gemeinsamen regionalen Lebensraum.
Die Frage nach der Identität ist tatsächlich entscheidend für die künftige Ausgestaltung der Region. Doch die Diskussion läuft in die falsche Richtung. Sie nährt sich am alten, sentimentalen Bild der dörflichen Schweiz und verkennt – oder, je nach Position, ignoriert gezielt – die realen Verhältnisse einer städtischen Agglomeration. Dafür gilt es ein Bewusstsein zu entwickeln: dass wir, eine Viertelmillion Menschen, uns alle im genau gleichen Permiter bewegen, privat und beruflich. Und damit auch politisch. Wenn das einmal in den Köpfen ist, dass wir alle voneinander abhängig und aufeinander angewiesen sind, wird das Ende der politischen Grenzen bloss noch Formsache sein.