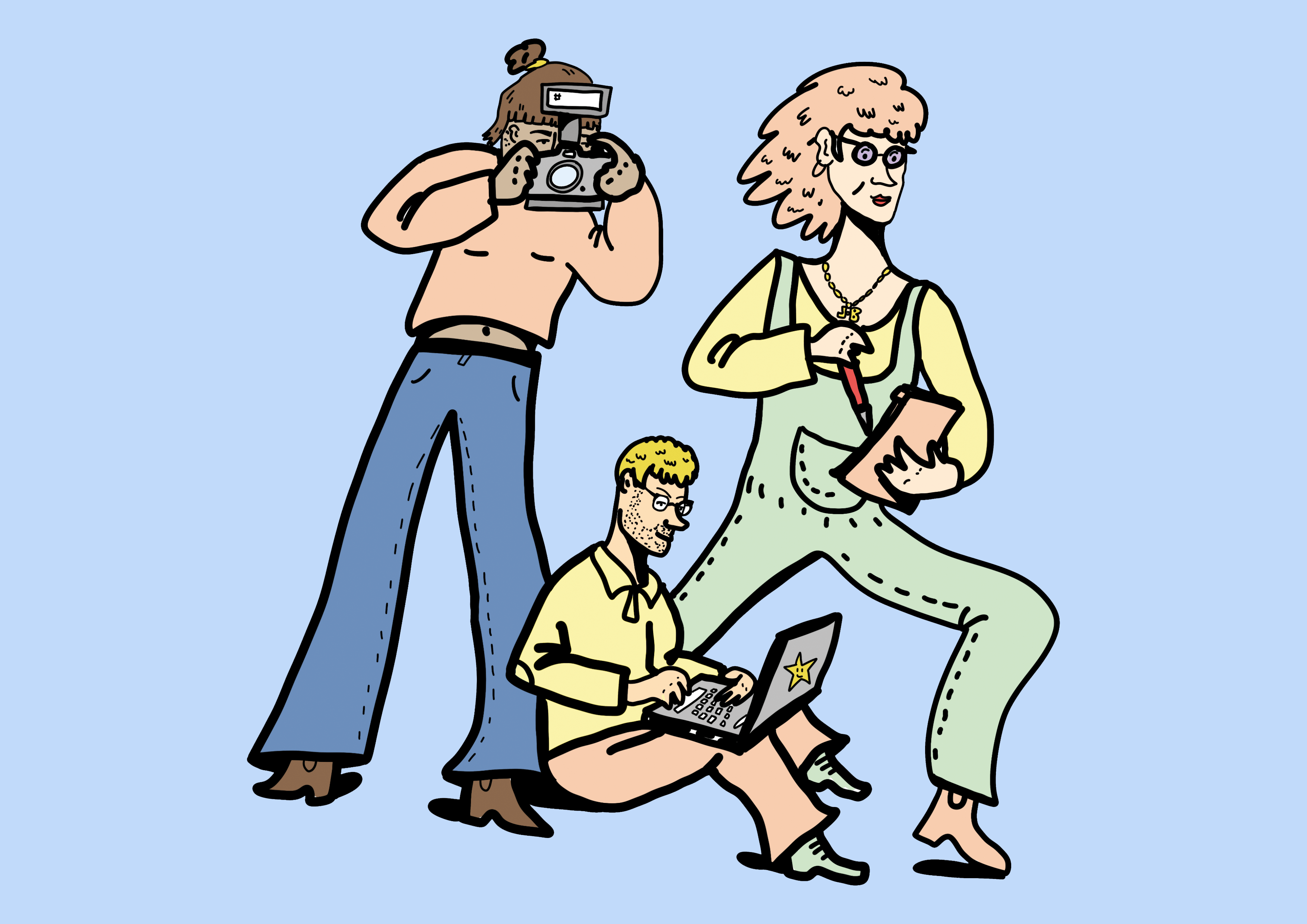Sie bezeichnen ihre Spoken-Word Texte als «art brut». Warum?
Weil sie zusammengesetzt sind aus Versatzstücken der Alltagssprache. Die Worte und Wendungen kommen direkt aus unseren Lebenszusammenhängen, aus unserer vertrauten Welt. Es ist ein Vorteil, wenn man mit gesprochener Sprache arbeitet. Als Autor kann man sich dort in einem reichen Fundus bedienen.
Alltagssprache ist aber noch lange nicht Literatur.
Natürlich nicht, da braucht es das genaue Hinhören, den Willen, die Worte und Sätze in neue Zusammenhänge zu stellen, sie zu rhythmisieren. Ich arbeite viel mit Wiederholungen, lasse die Zeilen tönen und klingen. Damit laden sich die Texte inhaltlich und emotional auf. Ein wunderbares Stilmittel, das viel möglich macht.
So wird aus Alltäglichem etwas Neues, manchmal Schräges?
Ja, man lässt den Ballast weg, reduziert den Text auf das Wesentliche und spielt mit den Elementen. Eigentlich paradox: Dadurch, dass man etwas wegnimmt, kommt etwas dazu.
«si wott das/u är wotts nid/oder si wotts itz/ u är ersch schpeter/ u schpeter wott ärs nüm/ aber si unbedingt»
Beat Sterchi
Vor Kurzen fand die Buchvernissage statt. Wie war es für Sie, die Texte mit dem Publikum zu erleben?
Nun, das Buch ist eine Sammlung von Texten, die nach und nach entstanden sind. Insofern habe ich die Geschichten alle schon mehrmals vor Publikum gelesen. Als Teil des Autorenkollektivs «Bern ist überall» habe ich die Chance, meine Arbeiten immer auch in der Livesituation zu testen. Oft zeigt sich beispielsweise erst da, wie viel Wiederholungen der Text verträgt oder welcher Rhythmus in den Sätzen liegt. Das kann sehr erhellend sein.
Was denken Sie, warum diese anhaltende Begeisterung für die gesprochene Mundartliteratur?
Ich glaube, die Leute mögen es einfach, in ihrer Alltagssprache angesprochen zu werden. Mit Mundartliteratur ist man sofort mitten in der Kommunikation. Die Geschichten lassen sich auf direkte, unmittelbare Art erzählen. Im Gegensatz dazu schafft die Hochsprache immer erst mal Distanz. Dazu kommt, dass in der eigenen Sprache immer auch viel Emotionales, Ungesagtes mitschwingt. So kann aus wenigen Zeilen wie «… si wott das, unär wotts nid, u si wotts itz, unär ersch speter, u speter wott ärs nümm, aber si unbedingt..» bereits eine Geschichte werden.
Wer die eigene Mundart pflegt, grenzt auch viele aus, weil diese sie nicht verstehen.
Ich pflege meine Sprache nicht, um mich von andern abzugrenzen. Wer mit und an der eigenen Sprache arbeitet, entwickelt neue Kompetenzen. Es sind Kompetenzen, die auch auf andere Sprachen und sprecherische Eigenheiten angewandt werden können. Das ermöglicht ein neugieriges sich Öffnen gegenüber Unbekanntem. Es ist also genau das Gegenteil von Abgrenzung.