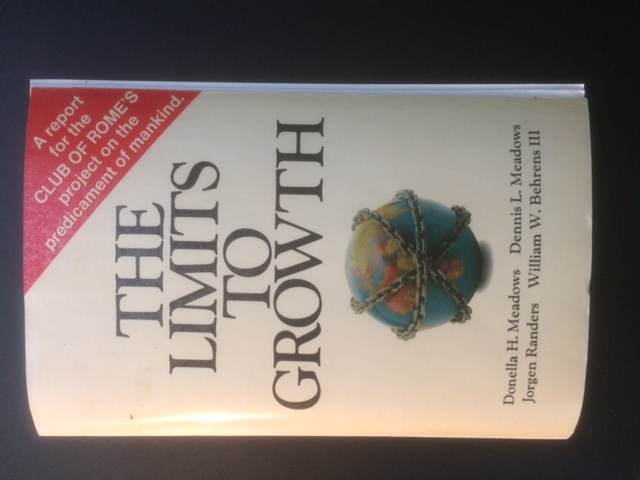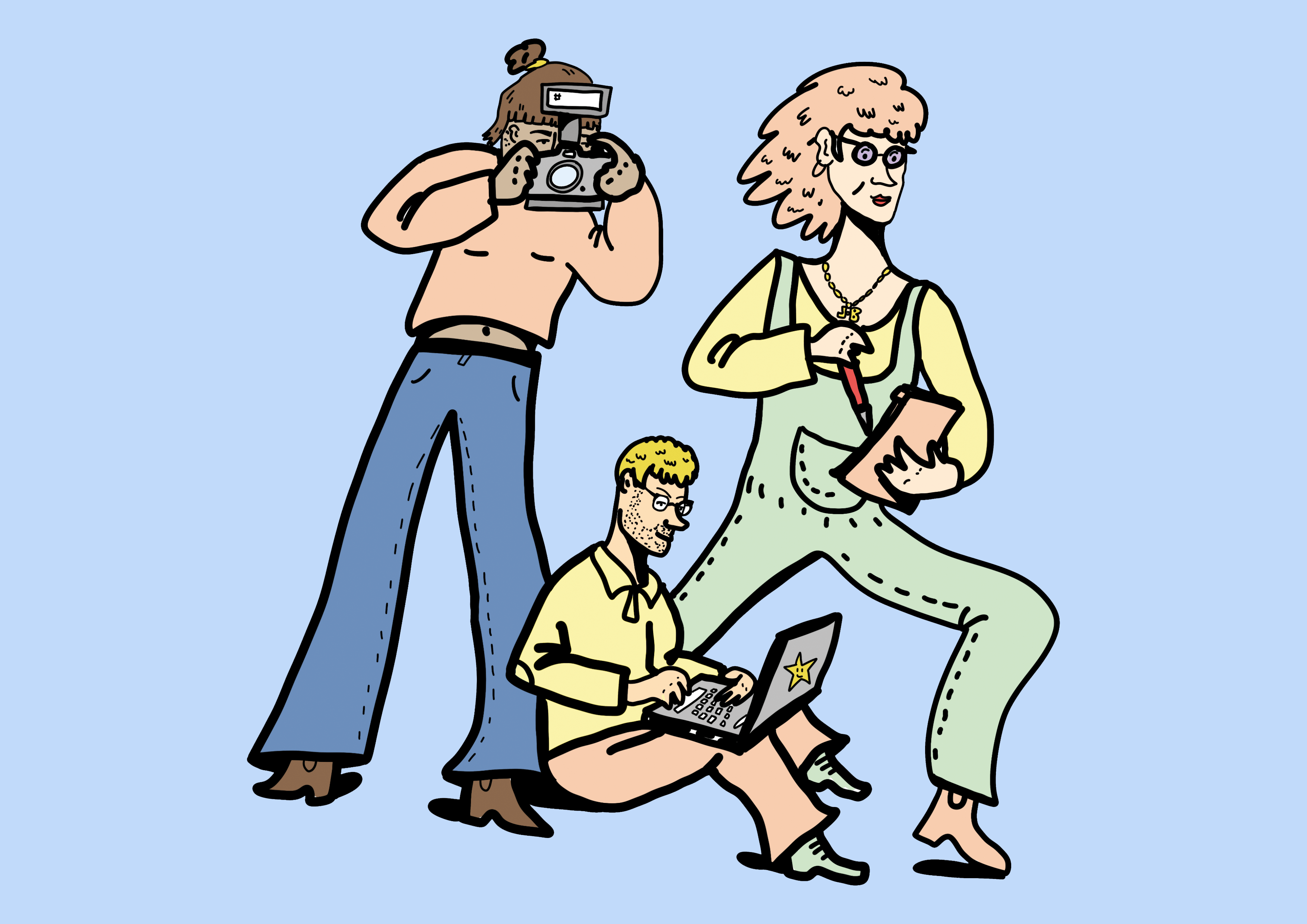«Wenn die gegenwärtige Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen unverändert anhält, werden die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten hundert Jahre erreicht.»
So lautete die Schlussfolgerung des Buchs «Die Grenzen des Wachstums», der Publikation einer Forschergruppe am Massachusetts Institute of Technology (MIT). Donella und Dennis Meadows leiteten die Gruppe und benutzten, eines der ersten Male in der Geschichte, eine Computersimulation.
Es war 1972. Das Buch schlug ein. Wer es gelesen hatte, konnte nicht zur Tagesordnung übergehen. In einer Zeit weitgehend fraglosen Wachstums der Wirtschaft und der Prosperität wurde die Endlichkeit ihrer Grundlage aufgezeigt. Erdöl, Kohle, Eisen, Aluminium, Kupfer, Mangan usw. alle Rohstoffe, die sich über Millionen von Jahren in und auf der Erde gebildet hatten und erst seit relativ kurzer Zeit systematisch genutzt wurden, bekamen ein Ablaufdatum. Die Studie sagte für jeden Rohstoff zwei Daten voraus: den Peak und das Ende der Verfügbarkeit. «Peak», Gipfel, bezeichnete den Zeitpunkt der grösstmöglichen Nutzung, das Ende war das Auslaufen jeglicher Nutzungsmöglichkeit des Rohstoffs. Das gleiche galt für die Ertragsfähigkeit des Bodens als Nahrungsgrundlage.
Das 205-seitige Buch hiess «The Limits to Growth; A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind». Es war eine vorgezogene Kurzfassung des technischen Berichts, der erst später erschien und die empirischen Unterlagen, die vorgenommenen Schätzungen und das mathematische Gleichungssystem darlegte.
Kommentar des Club of Rome
«The Limits to Growth» endete mit einem Kommentar zu seiner Bedeutung. Er stammt vom Vorstand des Club of Rome. Im Kommentar wird hervorgehoben, dass der quantitative Ansatz des Berichts nicht genüge, aber unentbehrlich sei, um die Natur des Problems zu begreifen. Durchgehend betont wird die Dringlichkeit der Problemlösung, die nicht der nächsten Generation überlassen werden dürfe. Nötig sei ein vernunftgemässes und dauerhaftes Gleichgewicht in der demographischen, ökonomischen und ressourcenschonenden Entwicklung. Gleichgewicht bedinge grundlegenden Wandel der Werte und Zielvorstellungen: individuell, national und weltweit. Der Kommentar mündet in einen Appell: «That man must explore himself – his goals and values – as much as the world he seeks to change. The dedication to both tasks must be unending. The crux oft he matter is not only whether the human species will survive, but even more whether it can survive without falling into a state of worthless existence.»
Jetzt Mitglied werden | Jetzt spenden
Weshalb der Kommentar? Es war der Club of Rome, eine 1968 vom italienischen Industriellen Aurelio Peccei gegründete private Vereinigung, der den Bericht in Auftrag gegeben hatte, unterstützt von der Volkswagen-Stiftung. Und es war der Club, der die gewonnenen Erkenntnisse weltweit verbreitete.
Einschätzungen
In einer gründlichen, kritischen Besprechung des Berichts in der konservativen Schweizerischen Handelszeitung schilderte 1972 W.A. Jöhr, Professor an der HSG, wie das MIT ein Weltmodell konstruierte. Dieses sollte die Auswirkungen der Industrialisierung, des Bevölkerungswachstums, der Unterernährung, des Abbaus von nicht erneuerbaren Rohstoffen und der Belastung der Umwelt erfassen und die Wechselbeziehungen zwischen den fünf Trends beschreiben. Die Parameter wurden unterteilt und die Beziehungen zwischen den Teilgrössen miteinander verknüpft, zum Beispiel die Verwendung von Mitteln zur Unkrautvernichtung auf die Gesundheit oder von zunehmendem Wohlstand auf die Familienplanung. Die Teilgrössen wurden auf 70 zurückliegende und für 130 Zukunftsjahre ermittelt, so dass ein Zeitraum von 200 Jahren dargestellt werden konnte. Solche Modellierung mit Hilfe des Computers war damals neu.
Der Bericht überraschte aber nicht nur durch differenzierte Simulationen, er sprach die Leserinnen und Leser auch mit anschaulichen Bildern an. Das Phänomen des exponentiellen Wachstums beschrieb er mit einer Seerose in einem Teich: Lange wächst die Seerose Stück um Stück bis sie nach 29 Tagen die Hälfte des Wassers bedeckt und alles andere Leben darin erstickt. Niemand denkt daran, sie zurückzuschneiden. Am 30. Tag ist es dafür zu spät: Das ganze Wasser ist bedeckt.
Jöhr kam zum Schluss, es sei richtig, dass vor dem technischen Bericht bereits eine Vorstudie veröffentlicht worden sei. Denn «die sich aus ihr ergebenden Probleme sind von so grosser Aktualität, dass keine Zeit – und sei es auch nur ein halbes Jahr – verloren werden durfte». Jöhr würdigte das Buch als Pionierleistung: «Sein Hauptverdienst besteht darin, dass es einen intensiven Denk- und Forschungsprozess im Bereich von Problemen, die für das Schicksal der Menschheit entscheidend sind, auslösen wird» (SHZ Nr. 22, 1.6.1972, S. 20).
Im gleichen Jahr forderte Erhard Eppler, Entwicklungsminister in der Regierung Brandt, einen «grundlegenden Wandel in unseren Wertsystemen» und mahnte, «unser Begriff von Leistung wird sich ändern müssen».
Doch nicht alle dachten so. Der SPIEGEL spitzte seine Kritik an der Kritik ungebremsten Wirtschaftswachstums zu im Satz: «Dazu bedarf es wirtschaftlichen Wachstums, nicht allgemeiner Stagnation zur Rettung der Art» (Nr. 21/1972, S. 129).
Nachhaltigkeit ist noch kein Schlüsselwort
Im Rückblick auf 49 Jahre fällt zweierlei auf.
Erstens taucht der Begriff «Nachhaltigkeit» in den sehr vielen Besprechungen und Kritiken des Buchs nicht auf. Es gibt ihn zwar seit Beginn des 18. Jahrhunderts in der Forstwirtschaft in dem Sinn, dass nicht mehr Holz geschlagen werden darf als jeweils nachwächst. Doch auf der politischen Agenda setzte er sich erst durch an der Konferenz der UNO über Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro. Als «sustainable» (engl. aushaltbar, ertragbar) gilt seither eine Entwicklung, die natürliche Ressourcen nutzt, ohne die Grundlage ihrer Erneuerung zu beschädigen. Dabei sind ökologische, ökonomische und soziale Aspekte gleichermassen zu beachten. Die theoretische Grundlage für eine umweltschonende Entwicklungspolitik hatte 1987 eine von der UNO eingesetzte Kommission unter Leitung der ehemaligen norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland geschaffen (Dokument «Unsere gemeinsame Zukunft»).
Zweitens: Im Zusammenhang mit der Warnung vor dem Wachstum der Weltbevölkerung und dem vom Westen und Norden der Welt vorangetriebenen exzessiven Verbrauch der natürlichen Ressourcen sind die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen in der sogenannten Dritten Welt kaum ein Thema. Keine Rede von Umweltstandards, von Menschen- und Kinderrechten im Zusammenhang mit der Gewinnung der Rohstoffe, wie dies etwa die vor kurzem in der Schweiz leider gescheiterte Konzernverantwortungsinitiative forderte.
Das Bewusstsein für beide Aspekte hat in erster Linie die Zivilgesellschaft, haben die NGOs verändert. In fast fünfzig Jahren haben sie die offizielle Politik zum Handeln bewegt. Langsam zwar, aber unumkehrbar. Das ist nicht wenig, auch wenn man zuweilen vor Ungeduld verzweifelt. Dann muss man sich die Grösse der Aufgabe vergegenwärtigen, die der Club of Rome 1972 aufgezeigt hat: «That man must explore himself – his goals and values – as much as the world he seeks to change».
Und jetzt?
Was hat das Buch bewirkt in fast einem halben Jahrhundert? Sehr wenig und sehr viel.
Sehr wenig: Wachstum gilt noch immer in Theorie und Praxis fast durchwegs als die erstrebenswerte oder gar unverzichtbare Dimension des Wirtschaftens. Die Idee: Nur wenn der Kuchen grösser wird, fällt auch etwas ab für die Ärmsten, die Armen, die Aufstrebenden, den unteren mittleren oberen Mittelstand überall auf der Welt. Nur dann stehen den am schlechtesten gestellten Menschen mit der Zeit zwei Dollars pro Tag zur Verfügung, um ihr Leben zu fristen, anstatt einem Dollar. Das geht für Viele nur mit möglichst hohem wirtschaftlichem Wachstum ohne Rücksicht auf die Nutzung nicht-erneuerbarer Rohstoffe, auf den Ausstoss von CO2, auf die Verschmutzung und Vermüllung von Böden und Meeren.
Sehr viel: Die Nachhaltigkeit hat es in die Bundesverfassung geschafft. Art. 73 BV sagt: «Bund und Kantone streben ein auf Dauer ausgewogenes Verhältnis zwischen der Natur und ihrer Erneuerungsfähigkeit einerseits und ihrer Beanspruchung durch den Menschen andererseits an.» Und Mirjam Staub-Bisang, Schweiz-Chefin des weltgrössten Vermögensverwalters Blackrock, erklärt im «Bund»-Interview vom 22. Dezember 2020 (S. 10/11): «Nachhaltigkeit ist heute ein Thema für jeden Unternehmensführer, jeden Anlagechef und jeden Stiftungsrat einer Pensionskasse. (…) Nachhaltige Anlagen schnitten in der Krise im März besser ab als konventionelle. (…) Es lohnt sich, auf Nachhaltigkeit zu setzen.»
Das Dilemma zwischen Wachstum und Nachhaltigkeit besteht weiter. Ein Gleichgewicht ist noch nicht erreicht. Doch das Bewusstsein für die Problemstellung ist in dem Mass gestiegen wie die Zeit für Lösungen knapp geworden ist.
Weshalb?
Weshalb bringen wir diesen Artikel in der Serie «Zeitzeugen», obwohl es um keine abgeschlossene Geschichte geht, sondern um ein fortwährendes Thema von anhaltender Bedeutung? Weshalb lassen wir nicht einzelne Personen zu Wort kommen, die über das «damals» oder auch das «heute» berichten? Weil wir alle, die 1972 erwachsen waren, Zeitzeugen sind mit unseren eigenen unterschiedlichen Wahrnehmungen und Erinnerungen. Weil wir das, was seither geschehen ist, was versucht wurde und was unversucht blieb, miterlebt haben. Und weil wir alle direkt und indirekt Gelegenheit hatten, Einfluss zu nehmen und mitzugestalten: Im Kleinen zum Beispiel beim Konsumieren, durch die eigene Lebensweise, mit oder ohne Auto, mit oder ohne Ölheizung, mit niedrigeren oder höheren Zimmertemperaturen, einem Pullover mehr oder weniger. Weil wir alle uns bewusst machen können, wie nachhaltig ist, was wir tun und lassen, etwa beim Abbau von Lithium für Batterien elektrischer Autos, bei der Schürfung seltener Erden für elektronischer Geräte, vor allem von Handys. Und weil wir nicht einfach Zeit-Zeugen sind, also Beobachtende einer nicht beeinflussbaren Entwicklung, sondern Einfluss haben, persönlich und politisch, auf deren Richtung und Verlauf. Weil Zeitzeugenschaft nicht ausschliesslich eine historische Dimension hat, sondern eine aktuelle Verantwortung einschliesst. Ob diese «historisch» ist, hängt vom Thema ab. Und – das wollen wir zeigen – von uns. Immer auch von uns.